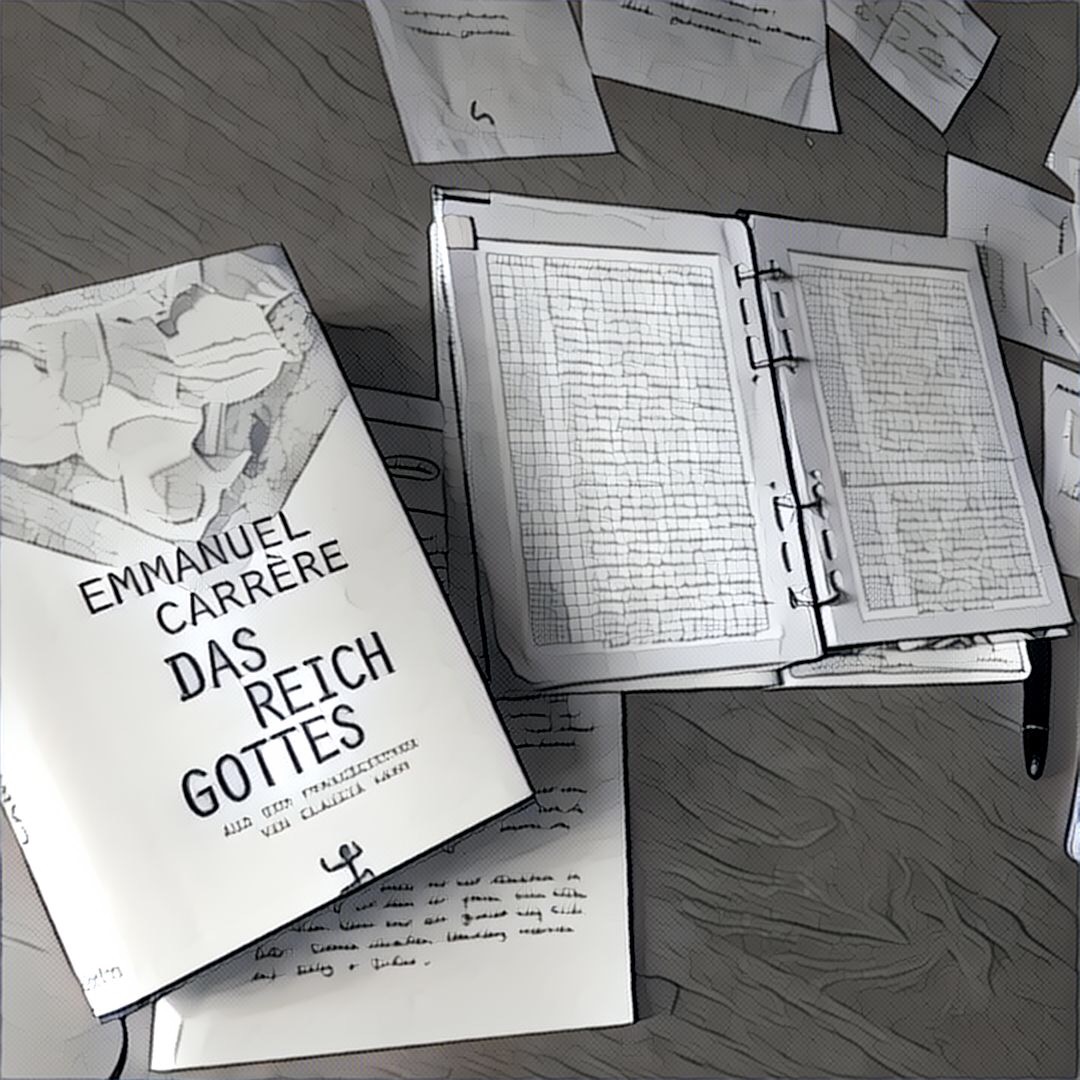„Was mich am meisten erstaunt, ist nicht, dass sich die Kirche derart weit von ihrem Ursprung entfernt hat, sondern, im Gegenteil, dass sie nach wie vor die Treue zu diesem Ursprung zu ihrem Ideal erklärt, selbst wenn sie es nicht schafft, treu zu bleiben. Niemals wurde vergessen, was am Anfang stand.“ (S. 496)
Dieser Anfang fasziniert Emmanuel Carrère. Sein Anfang 2016 auf Deutsch erschienenes Buch “Das Reich Gottes” versucht die Ursprünge christlichen Glaubens zu ermitteln. Der Text ist autobiografischer Großessay, romanhafte Nacherzählung, nachformulierende Aneignung biblischer Texte (Réécriture) und populärwissenschaftliche Reflexion in einer faszinierenden Mischung. Carrére folgt den Spuren der Figuren Paulus und Lukas, wobei er Fakten und Fiktion mischt, aber immer auch deutlich macht, wenn er beginnt zu spekulieren. Das unterscheidet ihn wohltuend von vielen theologischen Apologeten und atheistischen Religionskritikern.
„Wenn ich frei bin zu erfinden, dann unter der Bedingung, dass ich meine Erfindungen kenntlich mache und […] ihren Wahrscheinlichkeitsgrad zwischen Gesichertem, Anzunehmendem, Möglichem, und, kurz vor dem völlig Ausgeschlossenen, Nichtunmöglichem bestimme – einem Terrain, auf dem sich dieses Buch zum größten Teil bewegt.“ (S. 391)
Es gibt eine ganze Reihe guter Besprechungen und Vorstellungen des Buches, unter anderem von Katharina Döbler im Deutschlandradio, von Daniel Hass in ZEIT und auf der Rezensionenseite beim Perlentaucher, so dass ich mir hier eine vertiefte Vorstellung spare. Mich interessiert, was Carrère über die Schreibarbeit und seinen Umgang mit Notizen sagt.
Am Anfang steht ein Schreibimpuls:
„Ich war Zeuge von etwas geworden, das erzählt werden musste, und es oblag mir und niemand anderem, es zu erzählen. Danach verblasst diese Klarheit, und man verliert sie oft, aber wenn es sie nicht zumindest einen Moment lang gegeben hat, kann nichts geschafft werden.“ (S. 278)
Der Schreibimpuls hat eine Vorgeschichte. Carrère hatte getan, was man nicht tun sollte: in weinseliger Runde von einer Projekt-Idee erzählt, die Anfangsgeschichte der Christentums wie eine Science-Fiction-Fernsehserie aufzuziehen – Carrère ist auch Drehbuchautor. Während er Material dazu sammelte kam ihm die Idee, Menschen auf einer Pilgerreise nach ihrem Glauben heute zu befragen: Was ist aus dem Anfangsimpuls geworden? Allerdings fand er es zunehmend schwierig und peinlich, solche Gespräche anzubahnen, so dass er das Projekt zugunsten einer neuen Idee aufgab: Carrère hatte 20 Jahr zuvor eine sehr fromm-katholische Phase und in dieser Zeit 18 Hefte mit Notizen zum Johannesevangelium gefüllt. Eigentlich musste er also nur in seine eigenen Notate schauen. So suchte er die Hefte und begann an ihnen seine eigene Glaubensgeschichte nachzuvollziehen. Allerdings sorgte das für Irritationen: Seine alten Notizen klangen seltsamerweise zugleich aufrichtig und falsch. Sie erzählten von einer Glaubensbegeisterung, die sich im Laufe der Notizen zunehmend verflüchtigte. Das Ende der Notizen fiel seinerzeit zusammen mit dem Ende des eigenen Glaubens. Die Phase war vorbei. Doch nun entsteht eine neue Frage und sie wird zum entscheidenden Impuls, das Buch zu schreiben: Wie konnte es kommen, dass das tiefe Erleben eines Glaubens am Ende nur eine Phase ist, Ausdruck einer Lebenskrise, und 20 Jahre später ist Carrère der Mensch geworden, der zu werden er in der frommen Zeit befürchtete zu werden: “Ein Agnostiker – nicht mal gläubig genug, um Atheist zu sein.” (119)
Daraus entsteht schließlich das neue Schreibprojekt, und zwar zunächst einmal in Form zahlloser Notizen, die irgendwann zu einer neuen Einheit gestaltet werden wollen. Denn auch wenn Carrére als “guter Modernist” eher das Fragmentarische mag, will seine zwangsneurotische Seite ordnen und gestalten:
„Gerade ackere ich wie ein Pferd, um […] Tausende von Bleistiftnotizen unterzubringen, die ich zu verschiedenen Tageszeiten, während verschiedener Buchlektüren oder aus einer Laune heraus irgendwohin gekritzelt habe. Manchmal kommen mir Zweifel, ob diese Notizen so, wie sie sind, so frei, wie sie sich in den verschiedenen Heften oder unsortierten Ordnern herumtummeln, nicht viel lebendiger und lesbarer sind, als wenn sie geordnet, vereinheitlicht und durch geschickte Übergänge in einen Zusammenhang gebracht sind, aber es ist irgendwie stärker als ich: Was ich mag, was mir Sicherheit gibt und die Illusion, meine Zeit auf Erden nicht zu vergeuden, ist, Blut und Wasser zu schwitzen, um das, was mir durch den Kopf geht, zu einer homogenen, gebundenen Materie aus mehreren sich überlagernden Schichten zu verschmelzen. Und von diesen Schichten kann ich nie genug kriegen. Als guter Zwangsneurotiker plane ich immer, noch eine weitere hinzuzufügen und darüber noch eine Lasur, noch eine Lackschicht und was weiß ich noch alles, auf jeden Fall alles andere, als die Dinge unverbunden, unvollendet und vorläufig, das heißt außerhalb meiner Kontrolle zu belassen.“ (S. 309f)
Als die 18 Notizhefte entstanden, hat Carrére sich einen festgefügten Tagesablauf gegeben. Die Arbeit begann morgens mit der Bibellektüre und den Notizen. Danach folgt eine Zeit des Gebets – daraus wird später eine Meditationszeit. Erst wenn diese Dinge abgeschlossen waren folgte am Nachmittag das Schreiben für den Beruf. Carrère versteht sich in seinem Schreiben als Handwerker, auch wenn er gern Künstler wäre. Das Bild hatte er schon früh von sich:
„Ich konnte keinen anderen Sinn im Leben erkennen als den, ein großer Künstler zu sein – und ich hasste mich, weil ich glaubte, im besten Fall ein kleiner werden zu können.“ (S. 34)

Und auch wenn Carrère sich noch immer als Künstler sehen mag, er kann auch mit der anderen Rolle gut leben:
„Auch wenn ich hoffe, ein Künstler zu sein, sehe ich mich doch auch gern als einen an die Werkbank ketteten Handwerker, der seine Auftragsarbeiten rechtzeitig abliefert und seine Kunden zufrieden stellt.“ (S. 53)
In einer Arbeitsnotiz von Marguerite Yourcenars erkennt Carrère sich wieder, wenn auch mit einer Einschränkung. Carrère zitiert ausführlich Yourcenars Schreibregeln:
»[S]ich alles aneignen, alles lesen, alles zur Kenntnis nehmen und gleichzeitig die Exerzitien des Ignatius von Loyola oder die Methode jenes hinduistischen Asketen, der sich jahrelang abmüht, das Bild unter seinen geschlossenen Lidern ein wenig zu schärfen, den eigenen Zwecken dienstbar machen. Hinter Tausenden von Karteikarten das Aktuelle der Geschehnisse ermitteln; diesen steinernen Gesichtern ihre Bewegtheit, ihre lebendige Weichheit zurückgeben. Eher Vergnügen daran finden, zwei Texte, zwei Behauptungen, zwei Gedanken widersprüchlicher Natur in Übereinstimmung zu bringen, als sie sich aufheben zu lassen; in ihnen zwei unterschiedliche Facetten, eine Abfolge zweier Zustände ein und derselben Erscheinung zu sehen, eine Wirklichkeit, die glaubwürdig ist, weil beziehungsreich, und menschlich, weil vielgestaltig. Bemüht sein, einen Text des 2. Jahrhunderts mit den Augen, dem Geist und den Sinnen des 2. Jahrhunderts zu lesen; ihn in jener Mutterlauge baden lassen, die in den Zeitumständen besteht, alle zwischen uns und jenen Menschen gelagerte Gedanken- und Gefühlsschichten abtragen. Trotz allem Gebrauch machen – freilich klug, auf Vorstudien beschränkt – von den Möglichkeiten der Annäherung und Distanzierung, von den neuen Perspektiven, die nach und nach durch so viele Jahrhunderte oder Ereignisse ertrotzt wurden, die uns von diesem Text, diesem Ereignis, diesem Menschen trennen; sie in gewisser Weise nutzen wie Markierungen auf dem Weg zurück auf einen besonderen Punkt der Zeit zu. Sich die Schlagschatten untersagen; nicht erlauben, dass ein Atemhauch die Spiegelfläche beschlägt; nur nehmen, was es an höchst Beständigem, an Eigentlichem in uns, in den Erregungen der Sinne oder dem Wirken des Geistes gibt als Brücke zu jenen Menschen, die wie wir Oliven knabberten, Wein tranken, sich die Finger mit Honig verklebten, die gegen schneidenden Wind und peitschenden Regen ankämpften und sommers den Schatten einer Platane suchten, die genossen und dachten und alt wurden und starben.« (S. 310f)
Die Einschränkung ist: Carrère ist überzeugt, dass es nicht funktioniert, Schlagschatten und Atemhauch zu vermeiden. Die Aneignung ist persönliche Aneignung, die immer eigene Spuren hinterlässt. Das ist es, was auch “Das Reich Gottes” auszeichnet: Carrère verarbeitet viel Material, setzt sich mit Fragen der Exegese und Bibelkritik auseinander, versucht Positionen und Ereignisse zu rekonstruieren, aber bei allem sind Carrères Schlagschatten und Atemhauch unübersehbar. Das „Ich“-Sagen ist auch der Schlüssel zu seinem Verständnis der Position des Lukas. Ihn fasziniert der Ich-Erzähler Lukas – und gerade weil Lukas “Ich” sagt, hat Carrère “Lust, ihm nachzugehen und herauszufinden, wer sich hinter diesem ‚ich‘ verbirgt” (S. 121). Das Persönliche ist allerdings, wie Übersetzerin Claudia Hamm in ihrem lesenswerten Nachwort reflektiert, bei Carrère immer auch Maske, eine Methode, durch die Carrère sich verbirgt und zugleich schreibend selbst inszeniert.
Carrère, Emmanuel, Das Reich Gottes, übers. von C. Hamm. Berlin: Matthes & Seitz, Erste Auflage, 2016. 524 S., ISBN 9783957572264. [Amazon-Link] [buchhandel.de]