Wie verstehen eigentlich Praktische Theologen ihre homiletischen Ansätze praktisch? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn Homiletik als reflektierte Betrachtung der Predigtpraxis zielt nicht unbedingt auf die Praxis konkreter Predigtvorbereitung und -performanz. Insofern folgt der Homiletik-Band aus der Reihe „elementar“ bei V&R einer interessanten Konzeption: Vierzehn wichtige Homiletiker der Gegenwart stellen nicht nur ihren Ansatz selbst vor, sie präsentieren auch ein eigenes oder fremdes Predigtmanuskript, in dem sie das eigene Konzept gut wiedererkennen. „Homiletik in der Übersicht“ weiterlesen
Robinsons Phasen der Predigtvorbereitung
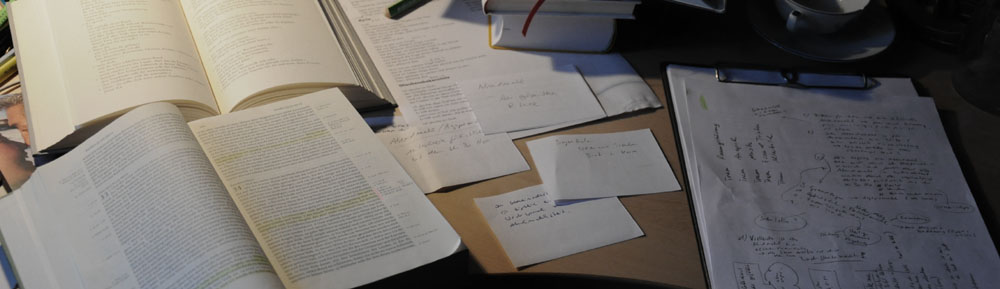
Haddon Wheeler Robinson, 1931 in New York geboren gilt als einflussreicher Homiletiker evangelikaler Prägung. Nach dem Studium war er zunächst Pastor einer Baptistengemeinde und unterrichte dann am konservativ-evangelikalen Dallas Theological Seminary. Nach der Promotion in Philosophie 1964 war er von 1979 bis 1991 Dozent und Rektor am Denver Theological Seminary, wo 1980 sein Buch „Biblical Preaching“ entstand. Seit 1991 hat er eine Homiletik-Professur an einer der größten evangelikalen Ausbildungsstätten der USA inne, dem Gordon-Conwell Theological Seminary.
Obwohl ich Robinsons theologischen Ansatz nicht teile und auch homiletische Einwände zu erheben haben, schätze ich „Biblical Preaching“ (dt.: Predige das Wort). Was mir gefällt ist Robinsons pragmatischer Ansatz: Kern der Predigtarbeit ist danach, sich darüber klar zu werden, was man sagen will, indem man seine Gedanken klar auf eine Kernaussage hin orientiert.
Für die Predigtvorbereitung schlägt Robinson zehn Phasen vor. Ein Schwerpunkt liegt darauf, sich zuerst über Predigtthema und Predigtzweck klar zu werden, bevor eine Gliederung der Predigt entworfen wird. Anschließend wird die Gliederung mit illustrierendem, reflektierendem und erläuterndem Material gefüllt.
Natürlich ergeben sich aus heutiger Sicht gleich zwei grundlegende Einwände. Der erste Einwand ist, dass so eine Schrittfolge zu starr ist. Angemessener erscheint mir heute ein Phasenmodell mit gröberen Schritten, das ein Hin-und-her-Springen zwischen verschiedenen Arbeitsschritten ermöglicht. Der zweite Einwand ist, dass die Illustrationen bloß als Füllmaterial für das Gedankenskelett verstanden werden. Heute gilt es dagegen, mit dem Material zu denken, so dass Gedanken, Geschichten und Illustrationen sich zu einem Gewebe verdichtet. Oder kurz: Die Geschichten sind die Predigt, nicht ihr Füllmaterial.
Stärken treten in diesem Phasenmodell an zwei Punkten hervor: Alle Predigtarbeit dreht sich darum, sich über Predigtthema und Predigtzweck klar zu werden. Und: Die Einleitung und den Schluss der Predigt überlegt man am besten am Ende.
Phase 1 – Auswahl des Predigttextes (43): In Robinsons freikirchlichem Kontext taucht zwar keine Perikopenordnung auf, doch auch eine Perikopenordnung bewahrt nicht vor der Entscheidung, sich rechtzeitig für einen Predigttext zu entscheiden.
Phase 2 – Studium des Bibeltextes (46): Hierunter fallen selbstredend exegetische Überlegungen.
Phase 3 – Erarbeitung des Textthemas (50): Robinson unterscheidet hier zwischen Textgegenstand (wovon der Text handelt) und der Textaussage (Was wird über den Gegenstand ausgesagt) Das Textthema lässt sich formulieren durch eine Verbindung von Textgegenstand und -aussage.
Phase 4 – Analyse des Textthemas mithilfe von drei grundsätzlichen Fragen (59): Was bedeutet diese Aussage (61), ist die Aussage heute noch gültig (63) und welche Konsequenzen ergeben sich daraus (69)?
Phase 6 – Festlegung des Predigtzwecks (86): Aus Text- und Predigtthema als Zusammenfassung der biblischen Botschaft wird als Predigtzweck daraus abgeleitet, wozu diese Botschaft dienen soll.
Phase 7 – Denke darüber nach, wie das Predigtthema am besten entfaltet wird, um den Predigtzweck zu erreichen. (91) Robinson stellt hier knapp fünf Gestaltungsmöglichkeiten von Predigten vor: Erklärung eine Aussage (92), Überprüfung einer Behauptung (95), Anwendung eines Prinzips (97), Erläuterung eines Themas (99) und das Erzählen einer Geschichte (101).
Phase 8 – Nachdem du entschieden hast, wie du das Predigtthema entfaltest, um den Predigtzweck zu erreichen, entwirft eine Predigtgliederung. (106) Für den Prediger zielt die Gliederung darauf, den Zusammenhang der Predigtteile nicht aus dem Blick zu verlieren. Für die Hörer erleichtert eine klare Gliederung, den Gedanken des Predigers zu folgen.
Phase 9 Fülle die Gliederung mit ergänzendem Material, welches die Punkte erklärt, prüft, illustriert oder zur Anwendung bringt. (113) Dazu nennt Robinson sechs Materialformen: Umformulierungen, Definitionen und Erklärungen, Sachinformationen (Tatsachen), Zitate, Erzählungen, Illustrationen
Phase 10 Bereite die Einleitung und den Schluss der Predigt vor. (131)
Robinsons Rat zum Zettelkasten
In Haddon Robinsons Buch „Predige das Wort“ (Originaltitel: Biblical Preaching) wird sehr schön der Einsatz von Zettelkästen für Prediger beschrieben. In seinem Kapitel über die lebendige Ausgestaltung eines Predigtentwurfes mit illustrierendem Material schreibt Robinson:
„Das meiste Material findet der Prediger zweifellos in seiner eigenen Sammlung. Deshalb sollte es sich ein gutes Ordnungssystem dafür anlegen. Denn was er dort für seine Predigt findet, hängt völlig davon ab, was und wie er es hinein getan hat. Es gibt viele Systeme, um die Ergebnisse des Studiums und Lebens zuordnen. Normalerweise benötigt man zweierlei Karteien. In die eine Großformatige ordnet man Predigtnotizen, Auszüge und Kopien so, wie sie sind. Sie können eingeteilt sein nach Themen oder nach den Büchern der Bibel.
„Robinsons Rat zum Zettelkasten“ weiterlesenHomiletik der Langeweile

Was Prediger mit ihrer Predigt erreichen wollen, lässt sich nicht allgemein sagen. Dass ein Prediger aber zumindest irgendetwas sagen will, wird normalerweise vorausgesetzt – auch wenn die Botschaft nicht immer ganz klar ist. Es gibt diesen alten Witz: Der Mann kommt vom Gottesdienst nach Hause kommt und sagt: „Heute hat der Pastor über 30 Minuten gepredigt.“ „Worüber denn?“, fragt die Ehefrau. Und der Mann antwortet: „Das hat er nicht gesagt.“ „Homiletik der Langeweile“ weiterlesen
Etwas zu einfach
 „So wie ihr wollt, dass euch Gottes Wort verkündigt wird, so verkündigt es auch!“, formuliert Christian Lehmann seinen homiletischen Imperativ (S. 145). Für Lehmann heißt das auf den Punkt gebracht: liebevoll, praktisch und kreativ zu predigen. Sein Buch „Einfach von Gott reden“ enthält dazu neben grundsätzlichen, theologischen Erwägungen zur Predigt und Überlegungen zur Predigtpraxis eine Reihe von Übungen mit Lösungsvorschlägen, auf die aus dem Hauptteil heraus verwiesen wird. Heraus kommt am Ende ein praxisorientiertes Arbeitsbuch zur Predigt, das allerdings nur mit Einschränkung zu empfehlen ist.
„So wie ihr wollt, dass euch Gottes Wort verkündigt wird, so verkündigt es auch!“, formuliert Christian Lehmann seinen homiletischen Imperativ (S. 145). Für Lehmann heißt das auf den Punkt gebracht: liebevoll, praktisch und kreativ zu predigen. Sein Buch „Einfach von Gott reden“ enthält dazu neben grundsätzlichen, theologischen Erwägungen zur Predigt und Überlegungen zur Predigtpraxis eine Reihe von Übungen mit Lösungsvorschlägen, auf die aus dem Hauptteil heraus verwiesen wird. Heraus kommt am Ende ein praxisorientiertes Arbeitsbuch zur Predigt, das allerdings nur mit Einschränkung zu empfehlen ist.
„Einfach von Gott reden“ ist durch einen pietistischen Jargon geprägt, dessen altertümelnder Sprachstil zuweilen fragen lässt, ob das Buch vielleicht die Neuausgabe einer älteren Auflage ist. Tatsächlich ist das Arbeitsbuch aber 2012 erstmals erschienen. Der Autor Christian Lehmann stammt ursprünglich aus dem Siegerland, war bis 2010 Studienassistent am Tübinger Albrecht-Bengel-Haus und hat vor kurzem seine erste Pfarrstelle in der Württembergischen Landeskirche angetreten. Seit 2011 ist er zudem Schriftleiter von „Zuversicht und Stärke“, einer Predigthilfe aus der pietistischen „Christusbewegung Lebendige Gemeinde“. Auch wenn Lehmann vor der Predigt in der „Sprache Kanaans“ warnt (S. 65f): Sein Predigtbuch ist davon selbst davon nicht frei. Wer nicht in diesem Jargon zu Hause ist, kann leicht darüber stolpern.
Lehmanns Ansatz ist zunächst einmal sympathisch: Gegen langweilige und blutleere Predigten ist es ihm wichtig „die biblische Botschaft frisch und mutig, klug und klar, lebensrelevant und alltagstauglich weiterzugeben“ (S. 11). Dabei geht er „von der einfachen Grundidee aus, dass die Bibel als Gottes Wort uns nicht nur lehrt, was wir weiterzusagen haben, sondern auch, wie wir das am besten tun“ (ebd.). Deshalb gilt Lehmann auch die Bibel als erstes, kreatives Hilfsmittel (vgl. S. 170f): „Unsere Aufgabe als Verkündiger besteht darin, mit dem Bibeltext zu sprechen, nicht über ihn.“ (S. 65)
Liebevoll predigen heißt für Lehmann, einfach (S. 101ff), verständlich (116ff) und anschaulich (S. 123ff) zu reden. Maßstab sind dabei die Hörerinnen und Hörer. Sie sollen Glauben nicht nur intellektuell verstehen, sondern vor allem praktisch und konkret erfahren – jenseits aller Gesetzlichkeit, die im Tun des Glaubens immer nur ein „Du sollst …“ sieht. Dem stellt Lehmann „Wie-Fragen“ des Glaubens gegenüber: „Wie sind wir gute Eltern, …besiege ich meine Angst, … liebe ich meinen Nachbarn …?“ (vgl. S. 161). Wenn Predigt auf solche konkreten Fragen praktische Antwort gibt, erfüllt sie ihre wichtige Aufgabe, Menschen von heute zu sagen, wie christlicher Glaube praktisch aussieht. Dabei stützt sich Lehmann auf eine Theologie der Vollmacht (S. 44ff), die es ihm ermöglicht, trotz der These, dass alles aktuelle, menschliche Reden von Gott begrenzt ist, dennoch davon auszugehen, dass ein verlässliches und wirkmächtiges Reden von Gott in der Predigt möglich ist.
Lehmanns Anspruch ist ein praktisch orientiertes Buch vorzulegen, kein Lehrbuch der Predigt. Von daher überrascht es allerdings, dass die konkreten Arbeitsschritte der Predigterstellung vage und zum Teil bloß idealistisch bleiben. So gilt für Lehmann die unbestreitbar richtige Faustregel „je mehr Zeit, desto besser“. Was das aber im Pfarralltag bedeutet, lässt Lehmann offen. Er watscht die Pfarrer ab, die offen zugeben, oft unter Zeitdruck vorbereiten zu müssen und präsentiert idealisierend zwei evangelikale Star-Prediger, die nach eigenen Angaben zwei bis vier (!) ganze Tage der Predigtvorbereitung widmen (vgl. S. 38). Jenseits von der Frage, ob das überhaupt realistisch ist, stellt sich zumindest für den Pfarrberuf die Frage, ob so ein Ziel tatsächlich ideal ist.
Die konkrete Predigtvorbereitung geschieht bei Lehmann im Dreischritt von Hören, Ringen und Prüfen. Dazu gibt Lehmann dem Leser zwar eine Reihe von Reflexionsfragen zur Predigtarbeit an die Hand, aber als wirkliches Modell der Predigtvorbereitung bleibt vieles zu unkonkret. Im praktischen Hauptteil gibt es vereinzelte Überlegungen zu Predigtsprache und -aufbau, ein systematisches Modell lässt sich aber nicht erkennen. Lehmann verharrt ganz in der alten Punkte-Predigt und nimmt zum Beispiel Impulse der New Homiletik schlicht nicht zur Kenntnis. Dabei könnte auch die pietistische Predigt durchaus von neuen, homiletischen Ideen profitieren.
Problematisch ist aber vor allem das hermeneutische Textmodell, das dem Ansatz zugrunde liegt. Diese Problematik kommt in Lehmanns Interpretation des homiletischen Dreiecks (S. 94f) besonders gut zum Ausdruck. Zunächst fällt auf, dass in Lehmanns Dreieck „Prediger“ und „Hörer“ nicht mit „Bibeltext“ in Verbindung gesetzt, sondern durch die Schreibweise „Gott/Bibeltext“ Gott und Bibeltext quasi gleichsetzt werden. Expressis verbis: „Wer nicht die ganze Heilige Schrift als Wort des lebendigen Gottes anerkennen will, der bestreitet letztlich ihre ganze Gültigkeit und Autorität.“ (S. 140). Verkündigung ist vor diesem Hintergrund immer nur aktualisierende Rede der einmaligen und grundsätzlichen Rede Gottes im biblischen Text. Das ist vor dem pietistischen Hintergrund Lehmanns nachvollziehbar, dürfte aber zuweilen die Geduld historisch-kritisch geschulter Predigerinnen und Prediger strapazieren. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht Zielgruppe von „Einfach von Gott reden“.
Schwieriger ist aber ein zweites Problem, das in Lehmanns Interpretation des homiletischen Dreiecks sichtbar wird: Lehmann reflektiert nur mangelhaft die Rolle des Predigers im Predigtgeschehen. Der Prediger steht nach Lehmann vor der Herausforderung „die Hörenden in der konkreten Situation mit Gottes Wort in Verbindung“ zu bringen (S. 96). Es ist positiv zu würdigen, wie sehr Lehmann die Rolle der Hörerinnen und Hörer im Predigtgeschehen wahrnimmt. Trotzdem fällt auf, dass das Kapitel über die Hörer (S. 94ff) vor allem ein Kapitel über den „liebevollen“ Umgang des Predigers mit den Hörern ist. Ich meine das nicht ironisch: Lehmann grenzt sich ausdrücklich von einem pietistisch-evangelikalen Predigtstil ab, der die Hörerinnen „senkrecht von oben“ mit dem Gotteswort konfrontiert. Aber er sieht die Aufgabe des Predigers darin, den Menschen dieses Gotteswort zu bringen und zu sagen. Ausdrücklich versteht Lehmann den Prediger als „Worttransporter“ (S. 65), der „den alten Inhalt der Bibel in der Sprache von heute weiterzusagen“ hat (ebd.). Der komplexen Situation des Predigtgeschehens wird das aber nicht gerecht.
Im Predigtgeschehen stehen Prediger, Hörer und Bibeltext in wechselseitigen Beziehungen zueinander. Das sieht Lehmann in Ansätzen zwar durchaus, zieht daraus aber nicht die Konsequenz, auch nach den spannungsvollen Wechselwirkungen zu fragen. Trotz allem Bemühen um eine Hörerorientierung bleiben darum die kreativen Potentiale letztlich ungenutzt. So wird die Spannung von biblischer und heutiger Sprache zwar als „Verkündigungsenergie“ (S. 66) erkannt, aber sofort kritisch der geistlichen Prüfung überantwortet, statt in ihr zunächst einmal eine innovative, kreative Kraft zu sehen. Die Überlegungen zum kreativen Predigen erschöpfen sich so lediglich in der Suche nach Alternativen zum „Frontalmonolog“ als Standardform. Als Lösungsmöglichkeiten werden z.B. Lied-, Bild-, Symbol- und Dialogpredigt, Anspiele und Bibliolog, interaktive Elemente und Fragen der Predigtinszenierung angerissen (S. 165ff). Das ist alles anderes als neu. Selbst die gerade für eine biblisch orientierte Predigtlehre interessante Frage nach einer narrativen Predigt wird nur angedeutet und die Antwort erschöpft sich in der Feststellung: „Unsere Verkündigung darf ruhig ‚narrativer’, erzählfreudiger werden.“ (S. 91) Zur Frage der freien Predigt verhält sich Lehmann zurückhaltend, rät allerdings zur Verschriftlichung der Predigt und empfiehlt, nicht spontan vom vorbereiteten Manuskript abzuweichen (vgl. S. 98f; S. 40). In Lehmanns Worttransport-Modell fällt also die Beschreibung des Spannungsfeldes zwischen Prediger, Hörer und Bibeltext weit hinter die aktuellen, homiletischen Diskussionen zurück und auch die Potentiale für eine tatsächlich kreative Predigpraxis bleiben letztlich ungenutzt.
Fazit: „Einfach von Gott reden“ ist kein Lehr-, sondern ein Arbeitsbuch mit pietistischem Hintergrund. Wem das Umfeld sprachlich und theologisch nahe ist, wird in Lehmanns Buch zwar nicht viel Neues erfahren, aber sicherlich Anstöße und Anregungen bekommen, die eigene Predigtpraxis zu bedenken. Da das Buch wenig homiletisches und exegetisches Wissen voraussetzt, kann es sich auch gut für Prädikantinnen und Prädikanten eignen, die an ihrer Predigtpraxis arbeiten möchten; für sie dürften vor allem die praktischen Übungen interessant sein. Homiletisch erreicht das Buch allerdings nicht den aktuellen Diskussionsstand und wer Impulse für eine kreative Predigtvorbereitung und alternative Predigtformen sucht, wird schnell enttäuscht sein.
Christian Lehmann: Einfach von Gott reden. Liebevoll, praktisch und kreativ predigen. SCM R. Brockhaus, Witten, 2012. ISBN 978-3-417-26469-2| 13,95 € | 238 S.
Nicht ganz präsent
 Kaum etwas ist schlimmer als eine vorgelesene Predigt. Wie wohltuend ist es da, wenn jemand frei predigen kann: das wirkt lebendig, dialogisch und hörerzugewand. Aber hat die freie Predigt tatsächlich nur Vorteile? Diese Frage stellen Alexander Deeg, Michael Meyer-Blanck und Christian Stäblein in ihrem Buch „Präsent predigen“. Ihre „Streitschrift wider die Ideologisierung der ‚freien’ Kanzelrede“ will eine Alternative aufzeigen zwischen vorgelesenem Manuskript und der manuskriptlosen, freien Predigt. Mit einer gemeinsamen Thesenreihe und drei Aufsätzen plädieren sie für eine Orientierung der Predigtpraxis am Begriff der homiletischen Präsenz. Aber leider verzetteln sie sich unnötigerweise dabei, eine Gegenposition aufzubauen, die so niemand vertritt, gegen die sie aber dennoch anargumentieren. Schade eigentlich, denn der Ansatz ist gar nicht so schlecht.
Kaum etwas ist schlimmer als eine vorgelesene Predigt. Wie wohltuend ist es da, wenn jemand frei predigen kann: das wirkt lebendig, dialogisch und hörerzugewand. Aber hat die freie Predigt tatsächlich nur Vorteile? Diese Frage stellen Alexander Deeg, Michael Meyer-Blanck und Christian Stäblein in ihrem Buch „Präsent predigen“. Ihre „Streitschrift wider die Ideologisierung der ‚freien’ Kanzelrede“ will eine Alternative aufzeigen zwischen vorgelesenem Manuskript und der manuskriptlosen, freien Predigt. Mit einer gemeinsamen Thesenreihe und drei Aufsätzen plädieren sie für eine Orientierung der Predigtpraxis am Begriff der homiletischen Präsenz. Aber leider verzetteln sie sich unnötigerweise dabei, eine Gegenposition aufzubauen, die so niemand vertritt, gegen die sie aber dennoch anargumentieren. Schade eigentlich, denn der Ansatz ist gar nicht so schlecht.
Predigt neu entstehen lassen
Deeg, Meyer-Blanck und Stäblein haben ein Hauptanliegen: Sie wollen zeigen, dass die schriftliche Arbeit an einem Manuskript ein unverzichtbares Element der Predigtvorbereitung ist. Sie betonen dabei: Das ausgearbeitete „Manuskript ist noch nicht die Predigt selbst“ (S. 13f). Zur Predigt wird das Manuskript erst durch den Predigtvortrag – durch die Aufführung und Inszenierung des Textes. Das schließt für die Autoren das Vorlesen des Manuskripts aus: Die Predigt muss auf der Kanzel neu entstehen – im Zusammenspiel von Schrift, Gemeinde und Prediger (S. 10f). Das klassische Memorieren bietet keine Alternative: Die Konzentration auf ein auswendig gelerntes Manuskript behindere den Prediger, präsent zu sein und in Kontakt mit den Zuhörern zu kommen (93f). Es braucht also eine Alternative zum bloßen Vorlesen und Auswendiglernen der Predigt.
Eine Alternative wäre der mehr oder minder freie Vortrag der Predigt. Aber was soll das heißen? Bereits Horst Hirschler hatte Ende der 80er Jahre vorgeschlagen, der Prediger möge zwar mit einem Manuskript auf die Kanzel gehen, er solle dort aber jeden Satz neu formulieren. Für Meyer-Blanck (S. 34) und Stäblein (S. 102) wäre das ein gangbarer Weg. Praxisorientierte Predigtbücher wie „Frei predigen“ von Arndt Elmar Schnepper und „Kein Blatt vor’m Mund“ von Volker A. Lehnert gehen noch einen Schritt weiter: Sie fordern dazu auf, sich gleich ganz ohne Manuskript auf die Kanzel zu wagen. Die moderne Vikarsausbildung ermutigt ebenfalls dazu. Das aber geht den Autoren zu weit: Präsentes Predigen braucht ihrer Meinung nach auch beim Predigtvortrag das Manuskript. Erst damit sei der Prediger wirklich in der Lage frei zu predigen.
Abgrenzung vom Sprechdenken
Das Kernproblem ist letzten Endes, wie Predigt auf der Kanzel entsteht. Der neuere Ansatz der freien Predigt greift dazu auf das so genannte „Sprechdenken“ zurück: Der Prediger durchdenkt laut sprechend den Predigtgang noch einmal. Der gesprochene Satz ist das Ergebnis dieses Neu-Durchdenkens und ist weder vorgelesen noch auswendig gelernt. Da dieser Ansatz zu dem Vorhaben der Autoren ähnelt, die Predigt beim Sprechen im Zusammenspiel von Schrift, Gemeinde und Prediger neu entstehen zu lassen, ist damit der Gegner ausgemacht: Es sind die Protagonisten des Sprechdenkens in der freien Predigt.
Im Sprechdenken, so ein erster Einwand, würden „Aufgabe und Form der Predigt [allzu schnell] zusammenfallen“ (S. 11): „Was eine Predigt ist und wie man sie macht, diese Schritte fallen hier zu früh und zu schnell unter dem Stichwort ‚freie Rede‘ zusammen“ (S. 12) – was auch immer das bedeuten mag. Es fehlt ein Argument. Man könnte genauso gut auch umgekehrt behaupten: Die Stärke der freien Predigt sei, dass Aufgabe und Form zusammen fallen. Damit wäre genauso viel und genauso wenig ausgesagt.
Ein zweiter Einwand bezieht sich darauf, die Form des Sprechdenkens eigne sicher methodisch eher für 5-8minütige Predigten wie in der katholischen Messe, nicht aber für „eine texthermeutische Predigt von 15-20 Minuten Dauer, wie sie von evangelischen Gottesdienstbesuchern erwartet wird“ (S. 12). Abgesehen davon, dass ein Beleg für die Behauptung der methodischen Unzulänglichkeit fehlt: Dass evangelische Gottesdienstbesucher a) eine texthermeutische Predigt erwarten, die b) 15-20 Minuten dauert, halte ich für eine ziemlich professoral-pastorale Perspektive. Auch wenn Stäblein die Fähigkeit zur freien Rede „für den pastoralen Alltag [als] unabdingbar“ ansieht (S. 104), möchte er dies doch nur für Andachten, Grußworte und Besuche gelten lassen, nicht für die Predigt. Die Argumentation zeigt eher, wie weit entfernt die akademische Theologie von der gemeindlichen Praxis entfernt ist.
Überzeugender erscheint da zunächst die Argumentation Meyer-Blancks (S. 50ff), der gegen die Anführung von Kleists Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ einwendet, Kleists Ansatz sei vorwiegend der eigenen Gedankenklärung geschuldet. Dass Kleists Ansatz nicht auf die öffentliche Rede ziele, wie Meyer-Blanck nahelegt, stimmt aber nicht: Kleist schreibt sogar, dass manche große Rede aus dem unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum entstanden ist. Meyer-Blancks Fazit, Kleists Methode eigne „sich für die Predigtvorbereitung, nicht für die Predigt selbst“ (52) stimmt daher nur begrenzt: Mit anderen über die geplante Predigt zu reden kann eine gute und wichtige Hilfe sein – hier stimmt Meyer-Blancks Hinweis – aber Kleist lässt sich sehr wohl auch für die Konzeption des Sprechdenkens als Zeuge aufrufen.
Die Einwände gegen das Sprechdenken sind letztlich nicht so stark, dass sich der Ansatz nicht als Methode eignen würde, die Predigt auf der Kanzel neu entstehen zu lassen. Zwar beklagen die Autoren zu Recht, dass eine wissenschaftliche Reflexion der freien Predigt in der gegenwärtigen Homiletik fehlt (S. 11). Die Schlussfolgerung, dass die Manuskriptorientierung in sämtlichen homiletischen Ansätzen aber die Einsicht widerspiegele, die freie Predigt entspreche eben nicht der Komplexität des Predigtgeschehens (S. 12f), ist allerdings reichlich gewagt. Deshalb versuchen die Autoren, grundsätzliche Probleme der freien Rede heraus zu arbeiten.
Gegen die freie Rede
Die Autoren drehen das Verständnis von freier Rede um: die freie Rede sei nur scheinbar frei, weil sie eine „im eigenen Gerede gefangene[..] Praxis“ (S. 9) sei, „ein unvorbereitetes und damit unfreies Herumreden“ (S. 10). Mit diesem immer wieder auftauchenden, argumentativen Zug beginnt allerdings die Verzettelung der Argumentation: Die Autoren sammeln verstreute Argumente gegen die freie Rede, verlieren dabei aber immer wieder aus dem Auge, von welcher Form freier Rede sie sprechen. Letztlich wird der Popanz einer Predigt aus dem Steggreif als Gegner aufgebaut, ungeachtet der Tatsache, dass erwähnte Gegenpositionen wie die von Schnepper und Lehnert einer solchen Praxis gerade nicht das Wort reden.
Statt den Weg zu gehen, überzeugend dazulegen wie Predigen in der „Dialektik von freiem, aktualisierendem Vortrag und präziser, bindender Vor- und Manuskriptarbeit geschieht“ (S. 11), verheddern sich die Autoren in dem Vorhaben, eine Streitschrift gegen die Ideologisierung der freien Predigt vorzulegen. Unter „Ideologie der freien Predigt“ verstehen sie die Ansicht: „nur die freie Predigt kann gute Predigt sein“ (S. 12). Abgesehen davon, dass auch diese These eine Popanzthese ist, wird der Begriff der „Ideologie“ hier falsch gebraucht. Das zeigt schon der Ausdruck „falsche Ideologisierung“ (S. 9): Ideologie ist grundsätzlich ein kritischer Begriff und Ideologisierung immer falsch. Alexander Deeg setzt „idealistisch“ und „ideologisch“ nahezu gleich (S. 60) und geht vom romantischen Idealismus ungebremst zur Ideologie des Nationalsozialismus über – ein zumindest gewagtes Manöver, das die Hochschätzung der freien Rede unter Ideologieverdacht stellen soll. Lassen wir den argumentativen Ausrutscher einmal dahingestellt, ist offenbar etwas ganz anderes gemeint: Die Autoren kritisieren nicht die Ideologisierung, sondern eine falsche Idealisierung der freien Rede.
Die Argumente sind allerdings recht dürftig. Möglicherweise wird die Analyse und Kritik an der freien Rede deshalb auch nicht systematisch vorgetragen, sondern sehr verteilt: So wird kritisiert, die freie Predigt sei unterkomplex sowie „handwerklich mäßig[…]“ (S. 9) und verfehle rhetorische Grundstandards (S. 19). Auch in exegetischer Hinsicht werden Mängel unterstellt, weil der Predigttext nicht angemessen gewürdigt würde: der Text werde, so der Einwand, zum Sprungbrett für eigene Assoziationen, der Gedankengang zerfasere, die Botschaft gerate in Gefahr zu verflachen (S. 14f). Zudem liefere die freie Rede die Predigt „ungefiltert“ der Person des Predigers aus: Die Person des Predigers dränge sich in den Vordergrund, sei verfangen in eigener Lebensgeschichte (S. 17) und seinem Habitus (S. 70), abhängig von seiner Überzeugungskraft, seiner Glaubwürdigkeit, seinem Humor und Charme (S. 73).
Einige Argumente klingen bemüht bis sogar (unfreiwillig) komisch – das sind insbesondere die Argumente, die auf die größte Stärke des freien Redens verweisen: den direkten Bezug zum Hörer. So hält etwa Meyer-Blanck „die undeutliche Artikulation“ (S. 32) für das größte Problem der freien Rede, weil sie es vor allem Nicht-Muttersprachlern schwierig mache, der Rede zu folgen. Die Autoren machen zugleich eine doppelte Missachtung der Hörer aus: Die erste Missachtung steckt im unterstellten Mangel an Komplexität, die eine „geistige und geistliche Unterforderung“ sei (S. 9). Die zweite Missachtung basiert darauf, dass der freie Prediger „sich vor allem auf seine persönliche Autorität verlässt“ und damit die Autorität der Gemeinschaft missachte (S. 10).
Auch Deegs Argument, die freie Rede stünde vor dem Problem einer „massiven Bevormundung der Hörenden“ (S. 74) wirkt bemüht und die Argumentationsgang ist in sich widersprüchlich: Die Hörerinnen und Hörer, so Deeg, würden mittels einer „bedrängenden, letztlich autoritären Rhetorik […] in ihrer Aufmerksamkeit gefesselt“ (S. 16). Hier wird das abschweifende Betrachten des welken Blumenschmucks oder Überlegungen zur Renovierungsbedürftigkeit des Fußbodens beim Hören einer langweiligen Predigt zur Tugend der Freiheit des Hörers umgedeutet, nicht zuhören zu müssen. Deeg greift sogar zu einem argumentativen Trick: Empirische Untersuchungen zur Predigtrezeption, die zeigen, wie selektiv Hörer hören, werden bei Deeg zu Belegen dafür „dass Predigthörende die eigene Freiheit im Predigtvollzug zu schätzen wissen“ (76). Das ist eine zumindest gewagte Interpretation der Rezeptionsästhetik. Schließlich fordert auch Deeg, die Predigt brauche eine Gestaltung, „die fasziniert“ (S.77): „Ein Redner muss die Zuhörer gewinnen wollen, sonst sollte er das Reden belassen.“ (S. 9)
Faulheit und Zeitmangel als Motive für die freie Predigt
Sicherlich: Die vorgebrachten Argumente können Probleme der freien Rede sein – sie sind aber fast vollständig auch auf die Manuskriptrede übertragbar. Das gilt selbst für eines der Hauptargumente gegen die Praxis der freien Rede: Die Autoren unterstellen den Pfarrerinnen und Pfarrern, dass Faulheit, und nicht theologische und homiletische Gründe das „Hauptmotiv“ (S. 13) für das freie Predigen sei. Schon Luther habe Predigten aus Zeitmangel nicht wörtlich ausgearbeitet (S. 23). In der Konzeption der freien Predigt werde der „bedauerliche Zeitmangel“ der Pfarrerschaft aber „theologisch überhöht (S. 13) und zu einem „Mäntelchen der Faulheit“ (S. 10). Insbesondere die Homilie kann für Meyer-Blanck zu einer gefährlichen „Verführung zur Faulheit“ (47) werden, weil der routinierte Prediger unvorbereitet und frei am Bibeltext entlang reden kann. Aber auch Modelle wie das lernpsychologische Schema machen es dem Prediger „sehr leicht aus dem Stegreif“ zu reden (47f).
Die schwächere Lesart des Arguments legt ihren Schwerpunkt nicht auf Faulheit, sondern auf den Zeitmangel: So rechnet Stäblein aufgrund empirischer Studien vor, dass im Pfarralltag weniger als drei Stunden Vorbereitungszeit für die Predigt übrig blieben (S. 116). Zugleich gesteht Stäblein – wenn auch nur in einer Fußnote – zu, „dass die ernsthaften Techniken zur Vorbereitung einer freien Predigt nicht weniger, sondern mehr Zeit benötigen als die manuskriptgebundene Predigt“ (S. 116). Tatsächlich könnte man Zeitmangel auch als Argument gegen die schnell herunter geschriebene und mangels merkbarer Struktur vorgelesene Predigt anführen – wenn man nicht sogar auf die aus dem Internet herunter geladene Predigt verweisen will. Die Argumente gegen die freie Rede sind sicherlich deshalb so schwach, weil die Autoren eigentlich gegen etwas anderes zielen: die schlecht vorbereitete Rede aus dem Steggreif. Dass diese in der Praxis durchaus vorkommen mag, will ich nicht bestreiten: Das Phänomen gibt es, mit all den angeführten Problemen. Aber: Der Missbrauch eines guten Konzepts widerlegt nicht das Konzept selbst (S. 10), wie die Autoren selbst am Anfang ihrer Thesenreihe feststellen. Erforderlich wäre daher, systematische Gründe für die Unangemessenheit der freien Rede als Methode der Predigt vorzulegen. Das gelingt den Autoren aber nicht.
Gute Ansätze
Die Autoren wollen eine Debatte über Sinn und Unsinn der freien Rede anstoßen – was zu begrüßen ist: Die Diskrepanz zwischen universitärer Homiletik und gemeindlicher Predigtpraxis bedarf einer Neuorientierung des theoretischen Instrumentariums. Dass Meyer-Blanck, Deeg und Stäblein mit ihrem Vorgehen scheitern, spricht nicht gegen die Notwendigkeit, die frei gehaltene Predigt homiletisch zu reflektieren. Schade ist nur, dass sich die Autoren so in der Polemik gegen die vermeintliche Ideologie der freien Rede verzetteln, dass die guten und bedenkenswerten Ansätze in den Hintergrund treten. Ich sehe drei wichtige Ansatzpunkte:
Erstens: Predigtarbeit braucht Zeit. Das ist nicht neu, aber es gilt, die aktuellen Bedingungen der Predigtarbeit in der Homiletik mit zu reflektieren. Was bedeutet es für die Predigt, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer oft nicht mehr als drei Stunden für die Predigtvorbereitung aufwenden können? Stäblein sieht im Schreiben eine Möglichkeit, ganz bewusst aus der Vielgestalt der mündlichen Alltagskommunikation auszusteigen und sich dadurch in „Selbstdisziplin und Hingabe“ (S.11) zu üben. Auch wenn man von der Engführung auf die schreibende Vorbereitung absieht: Predigtvorbereitung setzt ein funktionierendes System von Zeit- und Selbstmanagement voraus. Das geht letztlich über die Predigtvorbereitung im engeren Sinne hinaus: So haben bereits Heribert Arens und seine Mitautoren in „Kreativität und Predigtarbeit“ Anfang der 1980er Jahre von einer „offensiven Predigtarbeit“ geredet, die eingebettet ist in eine kreative Lebenshaltung und nicht nur von der Hand in den Mund lebt, das heißt: nicht immer nur die nächste Predigt im Blick hat. Ansonsten droht, was Stäblein „Auspredigen“ nennt: „eine verengte, auf die ermüdende Reproduktion des immer Gleichen eingefahrene, für das schöpferische Moment kaum noch offene Wahrnehmung der [Predigt-]Aufgabe“ (S. 111).
Zweitens: Schreiben ist eine unverzichtbare Methode der Predigtarbeit. Man muss es ja nicht gleich mit Meyer-Blanck übertreiben und behaupten „Predigerinnen und Prediger sind Dichter“ (S. 22). Das stellt einen zu hohen sprachlichen Anspruch an die Predigt, vor dem nicht nur die freie Predigt kapitulieren muss. Aber in der Predigtarbeit auf „Poesie, Sprachkunst und Zeichenbildung“ zu setzen (S. 10), das gelingt schreibend besser. Deeg ist hier etwas nüchterner, wenn er in Predigern zwar „manchmal auch Sprachkünstler“ (87) sieht, aber in erster Linie sind Prediger Spracharbeiter und Kunsthandwerker der Sprache – wie Journalisten und Schriftsteller. In der bisherigen Homiletik und Predigerausbildung ist dieser Aspekt deutlich zu kurz gekommen. Predigen lernen heißt darum immer auch: Schreiben lernen – und zwar zu allererst als Handwerk – und manchmal sogar als Kunst.
Drittens. Die schreibende Predigtvorbereitung bietet ein starkes methodisches Instrument: die Möglichkeit der Überarbeitung. Dieses Grundelement der Schreibarbeit wird von der Autoren zwar nicht so genannt, aber wenn Deeg von der „Chance der Distanzierung“ schreibt (S. 78ff), ist genau dies gemeint. In einem kleinen Exkurs zeigt Deeg, dass schon in der antiken Rhetorik Schreiben eine wichtige Technik der Redevorbereitung war, die zwei Vorteile mit sich brachte: Wer schreibt, verlangsamt den Sprachfluss und ermöglicht die Suche nach dem besten Ausdruck. Und wer schreibt, kann kritisch auf das Geschriebene schauen und es korrigieren. Überarbeitung meint letztlich beides. Wer auf das Schreiben prinzipiell verzichtet, bringt sich um eine der stärksten Techniken der Textproduktion (vgl. S. 80).
Fazit
Meyer-Blanck, Deeg und Stäblein legen ein Buch mit guten und bedenkenswerten Ansätzen vor: den Zeitaufwand der Predigtvorbereitung im Pfarralltag zu bedenken, die Stärken des Schreibens herauszuarbeiten und großen Chancen zu sehen, die die Technik der Überarbeitung eines Manuskriptes für den Predigtvortrag bringt, das sind Punkte, die zu diskutieren sind. Leider haben sie nur am Rande etwas mit der Konzeption präsenten Predigens zu tun. Die Autoren verlieren sich zu sehr in Scheingefechten mit Ansätzen einer freien Rede, die es so nicht gibt. Statt mit einer Streitschrift gegen eine vermeintliche Ideologisierung der freien Predigt wären die Autoren mit einem Plädoyer für das Schreiben als unverzichtbarem Element der Predigtvorbereitung und der Orientierung an homiletischer Präsenz besser gefahren. So bleibt das Konzept des präsenten Predigens eigentümlich blass und auch die zentrale These, dass gerade die solide Manuskriptarbeit eine große Freiheit beim Predigtvortrag ermögliche, wird nicht ausgearbeitet. Am Ende wünscht man sich, die Autoren hätten selbst von der Möglichkeit, ihr Manuskript gründlich zu überarbeiten, mehr Gebrauch gemacht.
Deeg, Alexander, Michael Meyer-Blanck, und Christian Stäblein: Präsent predigen. Eine Streitschrift wider die Ideologisierung der „freien“ Kanzelrede. 1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. ISBN 9783525620014 | 17,95 € | 118 S. [Amazon-Link]
Handwerkszeug für die Predigt
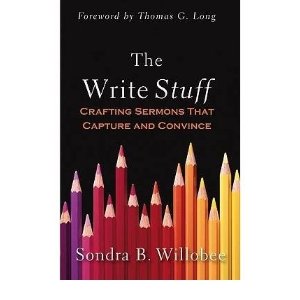 Predigten sind langweilig und oft einfach schlecht – mag das in seiner Allgemeinheit so auch nicht stimmen, so zeigt die Erfahrung als Predigthörer, dass da durchaus einiges dran ist. „Schlaffe Predigten“ (sagging sermons) sind denn auch das Hauptproblem, dem Sondra B. Willobee mit ihrem Buch „The Write Stuff“ (zu deutsch: Das Schreibzeug) zu Leibe rücken will. Gegen das Argument, Pfarrerinnen und Pfarrer seien oft zu überlastet, um an ihrer Predigtpraxis zu feilen, setzt Willobee die These, nicht Überlastung sei das Problem, sondern ein Mangel an handwerklichem Wissen (S. 2). Ihr Buch soll das entsprechende Handwerkszeug liefern.
Predigten sind langweilig und oft einfach schlecht – mag das in seiner Allgemeinheit so auch nicht stimmen, so zeigt die Erfahrung als Predigthörer, dass da durchaus einiges dran ist. „Schlaffe Predigten“ (sagging sermons) sind denn auch das Hauptproblem, dem Sondra B. Willobee mit ihrem Buch „The Write Stuff“ (zu deutsch: Das Schreibzeug) zu Leibe rücken will. Gegen das Argument, Pfarrerinnen und Pfarrer seien oft zu überlastet, um an ihrer Predigtpraxis zu feilen, setzt Willobee die These, nicht Überlastung sei das Problem, sondern ein Mangel an handwerklichem Wissen (S. 2). Ihr Buch soll das entsprechende Handwerkszeug liefern.
Lernen lässt sich das Handwerk von Schriftstellern. Bücher zum Kreativen Schreiben gibt es en masse. Sie können zeigen, wie man schreibend Aufmerksamkeit erzielt, Spannung erzeugt und durch eine lebendige Sprache das Interesse hält. Da Willobee aber doch Nachsicht mit den viel beschäftigten Pastoren hat, will sie mit ihrem Buch das konzentrierte Material eines ganzen Regals von Schreibbüchern liefern (S. 3). Spezielle Übungskapitel geben Tipps, das Gelesene praktisch zu vertiefen. Dadurch schreiben sich Predigten zwar nicht von allein: Gutes Predigen bleibt harte Arbeit (S. 6). Aber ähnlich wie ein Sportler, so Willobee, müssen auch Prediger ihre Kunst trainieren und üben (S. 7).
Willobee gibt dazu Hinweise für die konkrete Predigtvorbereitung, aber auch ganz allgemeine Tipps wie den, ein Journal zu benutzen (37). Es ist, so Willobee, für einen Prediger, was für einen Maler sein Skizzenbuch: es lehrt uns die Gewohnheit der Beobachtung, dient als Notizbuch für Geschichten, Zitate und Erkenntnisse (38) und kann helfen, die eigene Stimme zu finden (39).
Neben dem Journal empfiehlt Willobee das systematische Sammeln von Material in einem Ordner. Natürlich gibt es z.B. gute Sammlungen von Geschichten, die man in Predigten verwenden kann, aber solche Sammlungen verhindern letztlich einen vertieften eigenen Umgang mit Geschichten (S. 65): „Begnüg dich nicht mit einem Fertighaus“, lautet Willobees Rat (S. 64). Den weitergehenden Schritt, aus dem Ordner einen Zettelkasten zu machen, geht Willobee aber nicht.
Was Willobee vorstellt, ist angesichts des Vorhabens Wissen in konzentrierter Form anzubieten selbstverständlich nicht neu: Sie stellt dar, wie Schreiblehrer und Schriftsteller Schreibprozesse organisieren und überträgt dies auf die Predigtvorbereitung.
Orientiert am Bild des Hakens (Hook) geht es im ersten Teil zunächst darum, wie ein interessanter Predigteinstieg gelingen kann: „Ein guter Haken entspricht den Bedürfnissen unserer Gemeinde und bereitet sie darauf vor, den nächsten Schritt in der Predigt mit uns zu gehen.“ (26) Den Auftakt der Ratschläge macht dabei der Hinweis auf ein grundlegendes Instrument zur Spannungserzeugung: Die Rolle von Auseinandersetzungen und Konflikten. Leider erscheint diese sehr grundlegende Information nur wie ein Tipp unter weiteren und wird nicht in seiner grundlegenden Bedeutung für das Schreiben entfaltet.
Ein zweites Problem von Willobees Darstellung ist, dass der Eindruck entsteht, die Predigtarbeit beginne damit, einen guten Einstieg zu finden. Leider kranken viele Predigten eher daran, gut zu starten, aber den Impuls des Einstiegs nicht zu nutzen. Dass es oft besser ist, nicht mit dem Einstieg anzufangen, diesen Hinweis findet man in Willobees Buch nicht.
Dennoch sind die Tipps, die sie gibt, durchaus inspirierend. Die Zwischenüberschriften der einzelnen Kapitel markieren ganz gut, worum es in den einzelnen Abschnitten geht. Sie lesen sich jeweils wie eine These: „Spring mitten rein“ (16), „Stell eine Frage“ (19), „Skizziere einen Charakter“ (21), „Sag etwas prägnantes“ (22), „Beginn mit einem Bild“ (23). Dieser Stil, die Schreibempfehlung als kurze Handlungsanweisung über den jeweiligen Abschnitt zu stellen, zieht sich durch das ganze Buch. Leider gibt es kein detailliertes Inhaltsverzeichnis, dass diese Anweisungen übersichtlich zusammen stellt.
Der zweite Teil des Buches behandelt strukturelle Fragen des Schreibens und erläutert unter anderem die Bedeutung der Plotstruktur für die Predigt: „Predigten müssen sich bewegen (move) wie es Geschichten tun. Ob es nun ‚Geschichten-Predigten‘ sind oder nicht, sie müssen einen ‚Plot‘ haben, eine narraritive Bewegung (movement), vom Anfang über die Mitte bis zum Ende, ein Puls, der sich beschleunigt, wenn sich die Predigt entwickelt.“ (45) „Plot ist das Mittel, durch das sich eine Predigt bewegt.“ (48)
Im letzten Teil des Buches geht es um die sprachlichen Feinheiten. Dieser Teil ist mit „Stein“ überschrieben: ein Stein auf dem Schreibtisch der Autorin erinnert sie daran, auch sprachlich auf dem Boden zu bleiben. Kreatives Schreiben in der Predigtvorbereitung einzusetzen bedeutet nicht, in einen manierierten Schreibstil (purple prose, S. 99) zu verfallen, sondern sein Thema in konkreten, sinnlichen Bildern (S. 92ff) in der Alltagssprache (S. 95) auszudrücken. Warum erst an dieser Stelle Ricos Clustering-Methode vorgestellt wird, die ja eigentlich eine Methode der Ideenfindung ist, bleibt Willobees Geheimnis.
Dem Mittel, das Willobee zu Recht für das effektivste der Predigtvorbereitung hält, ist das Schlusskapitel vorbehalten: die Überarbeitung. Willobee verbindet das leider oft vernachlässigte Thema mit der Aufgabe des Zeitmanagements: Wer alles auf die letzte Minute macht, beraubt sich letztlich dieses effektivsten Mittels der Textarbeit (S. 103). „Schreiben ist Überarbeiten,“ zitiert Willobee den Dichter Jeffrey Skinner (S. 114).
Fazit: Am Ende steht auch für überlastete Pfarrerinnen und Pfarrer fest: Predigten schreiben sich auch mit kreativen Methoden nicht von selbst und eine gute Predigtvorbereitung braucht ihre Zeit. Das handwerkliche Schreibzeug führt letztlich dazu, sich über die Arbeit, die das Schreiben macht, klar zu werden und seine Predigtpraxis vielleicht zu straffen. Immerhin: Gemeindepfarrer, die Woche für Woche eine Predigt halten, produzieren im Laufe eines Jahres eine Textmenge, die gut und gerne einem Roman entspricht, hebt Thomas Long in seinem Vorwort hervor (S. XI). Sondra Willobee gelingt es, auf 114 Seiten zentrale Einsichten des Kreativen Schreibens vorzustellen und für die Predigtvorbereitung fruchtbar zu machen. Wer des Englischen mächtig ist und sich noch nicht viel mit Schreibmethoden auseinander gesetzt hat, findet hier eine gute Bündelung der Möglichkeiten.
Sondra B. Willobee: The Write Stuff: Crafting Sermons That Capture and Convince, Louisville, Kentucky: Westminster Pr, 2009.
ISBN 0664232817 | 12,99 € | 123 S. [Amazon-Link]
Buttricks Homiletic
Ich nehme einmal mehr David Buttricks Homiletik zur Hand und stelle mal wieder erstaunt fest: Das Schlechteste, was es über dieses Buch zu sagen gibt, ist: Es liegt immer noch nicht auf deutsch vor. Das ist eigentlich erstaunlich, weil es mittlerweile immerhin über 20 Jahre alt ist – und in mancherlei Hinsicht zu dem Besten gehört, was im Bereich der Homiletik in dieser Zeit veröffentlicht wurde. Wer „David Buttrick“ ergoogelt, wird kaum Seiten auf Deutsch finden. Wer nach den beiden Kernbegriffe „Moves and Structures“ sucht, landet schnell bei Martin Nicol und der dramaturgischen Homiletik – soweit ich sehe der einzige deutschsprachige Ansatz, der sich ernsthaft mit Buttrick auseinander setzt. Als ich das Buch vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal gelesen habe, hat es mir die Perspektive für eine ganz andere Homiletik eröffnet: eine Homiletik, die jenseits von der deutschen Aufsatz- und Vortragshomiletik auf Techniken der Inszenierung setzt. Ich will mir das Buch in den nächsten Wochen nochmal vornknöpfen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich es am liebsten selbst übersetzen, denn ohne deutsche Version wird es wahrscheinlich auch 25 Jahre nach Ersterscheinen (das wird nächstes Jahr sein) den meisten deutschen Predigern unbekannt sein.
P.S.: Ich stelle grad fest, dass es nicht mal in der englischen Wikipedia einen Eintrag zu Buttrick gibt. Bei homileticsonline.com gibt es zumindest ein Interview.
