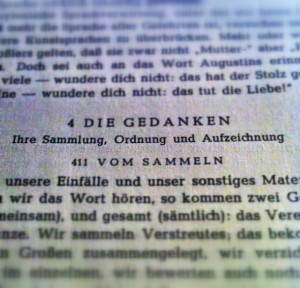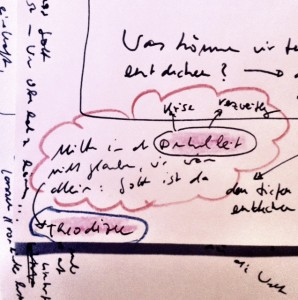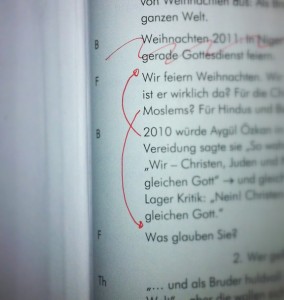Kaum etwas ist schlimmer als eine vorgelesene Predigt. Wie wohltuend ist es da, wenn jemand frei predigen kann: das wirkt lebendig, dialogisch und hörerzugewand. Aber hat die freie Predigt tatsächlich nur Vorteile? Diese Frage stellen Alexander Deeg, Michael Meyer-Blanck und Christian Stäblein in ihrem Buch „Präsent predigen“. Ihre „Streitschrift wider die Ideologisierung der ‚freien’ Kanzelrede“ will eine Alternative aufzeigen zwischen vorgelesenem Manuskript und der manuskriptlosen, freien Predigt. Mit einer gemeinsamen Thesenreihe und drei Aufsätzen plädieren sie für eine Orientierung der Predigtpraxis am Begriff der homiletischen Präsenz. Aber leider verzetteln sie sich unnötigerweise dabei, eine Gegenposition aufzubauen, die so niemand vertritt, gegen die sie aber dennoch anargumentieren. Schade eigentlich, denn der Ansatz ist gar nicht so schlecht.
Kaum etwas ist schlimmer als eine vorgelesene Predigt. Wie wohltuend ist es da, wenn jemand frei predigen kann: das wirkt lebendig, dialogisch und hörerzugewand. Aber hat die freie Predigt tatsächlich nur Vorteile? Diese Frage stellen Alexander Deeg, Michael Meyer-Blanck und Christian Stäblein in ihrem Buch „Präsent predigen“. Ihre „Streitschrift wider die Ideologisierung der ‚freien’ Kanzelrede“ will eine Alternative aufzeigen zwischen vorgelesenem Manuskript und der manuskriptlosen, freien Predigt. Mit einer gemeinsamen Thesenreihe und drei Aufsätzen plädieren sie für eine Orientierung der Predigtpraxis am Begriff der homiletischen Präsenz. Aber leider verzetteln sie sich unnötigerweise dabei, eine Gegenposition aufzubauen, die so niemand vertritt, gegen die sie aber dennoch anargumentieren. Schade eigentlich, denn der Ansatz ist gar nicht so schlecht.
Predigt neu entstehen lassen
Deeg, Meyer-Blanck und Stäblein haben ein Hauptanliegen: Sie wollen zeigen, dass die schriftliche Arbeit an einem Manuskript ein unverzichtbares Element der Predigtvorbereitung ist. Sie betonen dabei: Das ausgearbeitete „Manuskript ist noch nicht die Predigt selbst“ (S. 13f). Zur Predigt wird das Manuskript erst durch den Predigtvortrag – durch die Aufführung und Inszenierung des Textes. Das schließt für die Autoren das Vorlesen des Manuskripts aus: Die Predigt muss auf der Kanzel neu entstehen – im Zusammenspiel von Schrift, Gemeinde und Prediger (S. 10f). Das klassische Memorieren bietet keine Alternative: Die Konzentration auf ein auswendig gelerntes Manuskript behindere den Prediger, präsent zu sein und in Kontakt mit den Zuhörern zu kommen (93f). Es braucht also eine Alternative zum bloßen Vorlesen und Auswendiglernen der Predigt.
Eine Alternative wäre der mehr oder minder freie Vortrag der Predigt. Aber was soll das heißen? Bereits Horst Hirschler hatte Ende der 80er Jahre vorgeschlagen, der Prediger möge zwar mit einem Manuskript auf die Kanzel gehen, er solle dort aber jeden Satz neu formulieren. Für Meyer-Blanck (S. 34) und Stäblein (S. 102) wäre das ein gangbarer Weg. Praxisorientierte Predigtbücher wie „Frei predigen“ von Arndt Elmar Schnepper und „Kein Blatt vor’m Mund“ von Volker A. Lehnert gehen noch einen Schritt weiter: Sie fordern dazu auf, sich gleich ganz ohne Manuskript auf die Kanzel zu wagen. Die moderne Vikarsausbildung ermutigt ebenfalls dazu. Das aber geht den Autoren zu weit: Präsentes Predigen braucht ihrer Meinung nach auch beim Predigtvortrag das Manuskript. Erst damit sei der Prediger wirklich in der Lage frei zu predigen.
Abgrenzung vom Sprechdenken
Das Kernproblem ist letzten Endes, wie Predigt auf der Kanzel entsteht. Der neuere Ansatz der freien Predigt greift dazu auf das so genannte „Sprechdenken“ zurück: Der Prediger durchdenkt laut sprechend den Predigtgang noch einmal. Der gesprochene Satz ist das Ergebnis dieses Neu-Durchdenkens und ist weder vorgelesen noch auswendig gelernt. Da dieser Ansatz zu dem Vorhaben der Autoren ähnelt, die Predigt beim Sprechen im Zusammenspiel von Schrift, Gemeinde und Prediger neu entstehen zu lassen, ist damit der Gegner ausgemacht: Es sind die Protagonisten des Sprechdenkens in der freien Predigt.
Im Sprechdenken, so ein erster Einwand, würden „Aufgabe und Form der Predigt [allzu schnell] zusammenfallen“ (S. 11): „Was eine Predigt ist und wie man sie macht, diese Schritte fallen hier zu früh und zu schnell unter dem Stichwort ‚freie Rede‘ zusammen“ (S. 12) – was auch immer das bedeuten mag. Es fehlt ein Argument. Man könnte genauso gut auch umgekehrt behaupten: Die Stärke der freien Predigt sei, dass Aufgabe und Form zusammen fallen. Damit wäre genauso viel und genauso wenig ausgesagt.
Ein zweiter Einwand bezieht sich darauf, die Form des Sprechdenkens eigne sicher methodisch eher für 5-8minütige Predigten wie in der katholischen Messe, nicht aber für „eine texthermeutische Predigt von 15-20 Minuten Dauer, wie sie von evangelischen Gottesdienstbesuchern erwartet wird“ (S. 12). Abgesehen davon, dass ein Beleg für die Behauptung der methodischen Unzulänglichkeit fehlt: Dass evangelische Gottesdienstbesucher a) eine texthermeutische Predigt erwarten, die b) 15-20 Minuten dauert, halte ich für eine ziemlich professoral-pastorale Perspektive. Auch wenn Stäblein die Fähigkeit zur freien Rede „für den pastoralen Alltag [als] unabdingbar“ ansieht (S. 104), möchte er dies doch nur für Andachten, Grußworte und Besuche gelten lassen, nicht für die Predigt. Die Argumentation zeigt eher, wie weit entfernt die akademische Theologie von der gemeindlichen Praxis entfernt ist.
Überzeugender erscheint da zunächst die Argumentation Meyer-Blancks (S. 50ff), der gegen die Anführung von Kleists Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ einwendet, Kleists Ansatz sei vorwiegend der eigenen Gedankenklärung geschuldet. Dass Kleists Ansatz nicht auf die öffentliche Rede ziele, wie Meyer-Blanck nahelegt, stimmt aber nicht: Kleist schreibt sogar, dass manche große Rede aus dem unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum entstanden ist. Meyer-Blancks Fazit, Kleists Methode eigne „sich für die Predigtvorbereitung, nicht für die Predigt selbst“ (52) stimmt daher nur begrenzt: Mit anderen über die geplante Predigt zu reden kann eine gute und wichtige Hilfe sein – hier stimmt Meyer-Blancks Hinweis – aber Kleist lässt sich sehr wohl auch für die Konzeption des Sprechdenkens als Zeuge aufrufen.
Die Einwände gegen das Sprechdenken sind letztlich nicht so stark, dass sich der Ansatz nicht als Methode eignen würde, die Predigt auf der Kanzel neu entstehen zu lassen. Zwar beklagen die Autoren zu Recht, dass eine wissenschaftliche Reflexion der freien Predigt in der gegenwärtigen Homiletik fehlt (S. 11). Die Schlussfolgerung, dass die Manuskriptorientierung in sämtlichen homiletischen Ansätzen aber die Einsicht widerspiegele, die freie Predigt entspreche eben nicht der Komplexität des Predigtgeschehens (S. 12f), ist allerdings reichlich gewagt. Deshalb versuchen die Autoren, grundsätzliche Probleme der freien Rede heraus zu arbeiten.
Gegen die freie Rede
Die Autoren drehen das Verständnis von freier Rede um: die freie Rede sei nur scheinbar frei, weil sie eine „im eigenen Gerede gefangene[..] Praxis“ (S. 9) sei, „ein unvorbereitetes und damit unfreies Herumreden“ (S. 10). Mit diesem immer wieder auftauchenden, argumentativen Zug beginnt allerdings die Verzettelung der Argumentation: Die Autoren sammeln verstreute Argumente gegen die freie Rede, verlieren dabei aber immer wieder aus dem Auge, von welcher Form freier Rede sie sprechen. Letztlich wird der Popanz einer Predigt aus dem Steggreif als Gegner aufgebaut, ungeachtet der Tatsache, dass erwähnte Gegenpositionen wie die von Schnepper und Lehnert einer solchen Praxis gerade nicht das Wort reden.
Statt den Weg zu gehen, überzeugend dazulegen wie Predigen in der „Dialektik von freiem, aktualisierendem Vortrag und präziser, bindender Vor- und Manuskriptarbeit geschieht“ (S. 11), verheddern sich die Autoren in dem Vorhaben, eine Streitschrift gegen die Ideologisierung der freien Predigt vorzulegen. Unter „Ideologie der freien Predigt“ verstehen sie die Ansicht: „nur die freie Predigt kann gute Predigt sein“ (S. 12). Abgesehen davon, dass auch diese These eine Popanzthese ist, wird der Begriff der „Ideologie“ hier falsch gebraucht. Das zeigt schon der Ausdruck „falsche Ideologisierung“ (S. 9): Ideologie ist grundsätzlich ein kritischer Begriff und Ideologisierung immer falsch. Alexander Deeg setzt „idealistisch“ und „ideologisch“ nahezu gleich (S. 60) und geht vom romantischen Idealismus ungebremst zur Ideologie des Nationalsozialismus über – ein zumindest gewagtes Manöver, das die Hochschätzung der freien Rede unter Ideologieverdacht stellen soll. Lassen wir den argumentativen Ausrutscher einmal dahingestellt, ist offenbar etwas ganz anderes gemeint: Die Autoren kritisieren nicht die Ideologisierung, sondern eine falsche Idealisierung der freien Rede.
Die Argumente sind allerdings recht dürftig. Möglicherweise wird die Analyse und Kritik an der freien Rede deshalb auch nicht systematisch vorgetragen, sondern sehr verteilt: So wird kritisiert, die freie Predigt sei unterkomplex sowie „handwerklich mäßig[…]“ (S. 9) und verfehle rhetorische Grundstandards (S. 19). Auch in exegetischer Hinsicht werden Mängel unterstellt, weil der Predigttext nicht angemessen gewürdigt würde: der Text werde, so der Einwand, zum Sprungbrett für eigene Assoziationen, der Gedankengang zerfasere, die Botschaft gerate in Gefahr zu verflachen (S. 14f). Zudem liefere die freie Rede die Predigt „ungefiltert“ der Person des Predigers aus: Die Person des Predigers dränge sich in den Vordergrund, sei verfangen in eigener Lebensgeschichte (S. 17) und seinem Habitus (S. 70), abhängig von seiner Überzeugungskraft, seiner Glaubwürdigkeit, seinem Humor und Charme (S. 73).
Einige Argumente klingen bemüht bis sogar (unfreiwillig) komisch – das sind insbesondere die Argumente, die auf die größte Stärke des freien Redens verweisen: den direkten Bezug zum Hörer. So hält etwa Meyer-Blanck „die undeutliche Artikulation“ (S. 32) für das größte Problem der freien Rede, weil sie es vor allem Nicht-Muttersprachlern schwierig mache, der Rede zu folgen. Die Autoren machen zugleich eine doppelte Missachtung der Hörer aus: Die erste Missachtung steckt im unterstellten Mangel an Komplexität, die eine „geistige und geistliche Unterforderung“ sei (S. 9). Die zweite Missachtung basiert darauf, dass der freie Prediger „sich vor allem auf seine persönliche Autorität verlässt“ und damit die Autorität der Gemeinschaft missachte (S. 10).
Auch Deegs Argument, die freie Rede stünde vor dem Problem einer „massiven Bevormundung der Hörenden“ (S. 74) wirkt bemüht und die Argumentationsgang ist in sich widersprüchlich: Die Hörerinnen und Hörer, so Deeg, würden mittels einer „bedrängenden, letztlich autoritären Rhetorik […] in ihrer Aufmerksamkeit gefesselt“ (S. 16). Hier wird das abschweifende Betrachten des welken Blumenschmucks oder Überlegungen zur Renovierungsbedürftigkeit des Fußbodens beim Hören einer langweiligen Predigt zur Tugend der Freiheit des Hörers umgedeutet, nicht zuhören zu müssen. Deeg greift sogar zu einem argumentativen Trick: Empirische Untersuchungen zur Predigtrezeption, die zeigen, wie selektiv Hörer hören, werden bei Deeg zu Belegen dafür „dass Predigthörende die eigene Freiheit im Predigtvollzug zu schätzen wissen“ (76). Das ist eine zumindest gewagte Interpretation der Rezeptionsästhetik. Schließlich fordert auch Deeg, die Predigt brauche eine Gestaltung, „die fasziniert“ (S.77): „Ein Redner muss die Zuhörer gewinnen wollen, sonst sollte er das Reden belassen.“ (S. 9)
Faulheit und Zeitmangel als Motive für die freie Predigt
Sicherlich: Die vorgebrachten Argumente können Probleme der freien Rede sein – sie sind aber fast vollständig auch auf die Manuskriptrede übertragbar. Das gilt selbst für eines der Hauptargumente gegen die Praxis der freien Rede: Die Autoren unterstellen den Pfarrerinnen und Pfarrern, dass Faulheit, und nicht theologische und homiletische Gründe das „Hauptmotiv“ (S. 13) für das freie Predigen sei. Schon Luther habe Predigten aus Zeitmangel nicht wörtlich ausgearbeitet (S. 23). In der Konzeption der freien Predigt werde der „bedauerliche Zeitmangel“ der Pfarrerschaft aber „theologisch überhöht (S. 13) und zu einem „Mäntelchen der Faulheit“ (S. 10). Insbesondere die Homilie kann für Meyer-Blanck zu einer gefährlichen „Verführung zur Faulheit“ (47) werden, weil der routinierte Prediger unvorbereitet und frei am Bibeltext entlang reden kann. Aber auch Modelle wie das lernpsychologische Schema machen es dem Prediger „sehr leicht aus dem Stegreif“ zu reden (47f).
Die schwächere Lesart des Arguments legt ihren Schwerpunkt nicht auf Faulheit, sondern auf den Zeitmangel: So rechnet Stäblein aufgrund empirischer Studien vor, dass im Pfarralltag weniger als drei Stunden Vorbereitungszeit für die Predigt übrig blieben (S. 116). Zugleich gesteht Stäblein – wenn auch nur in einer Fußnote – zu, „dass die ernsthaften Techniken zur Vorbereitung einer freien Predigt nicht weniger, sondern mehr Zeit benötigen als die manuskriptgebundene Predigt“ (S. 116). Tatsächlich könnte man Zeitmangel auch als Argument gegen die schnell herunter geschriebene und mangels merkbarer Struktur vorgelesene Predigt anführen – wenn man nicht sogar auf die aus dem Internet herunter geladene Predigt verweisen will. Die Argumente gegen die freie Rede sind sicherlich deshalb so schwach, weil die Autoren eigentlich gegen etwas anderes zielen: die schlecht vorbereitete Rede aus dem Steggreif. Dass diese in der Praxis durchaus vorkommen mag, will ich nicht bestreiten: Das Phänomen gibt es, mit all den angeführten Problemen. Aber: Der Missbrauch eines guten Konzepts widerlegt nicht das Konzept selbst (S. 10), wie die Autoren selbst am Anfang ihrer Thesenreihe feststellen. Erforderlich wäre daher, systematische Gründe für die Unangemessenheit der freien Rede als Methode der Predigt vorzulegen. Das gelingt den Autoren aber nicht.
Gute Ansätze
Die Autoren wollen eine Debatte über Sinn und Unsinn der freien Rede anstoßen – was zu begrüßen ist: Die Diskrepanz zwischen universitärer Homiletik und gemeindlicher Predigtpraxis bedarf einer Neuorientierung des theoretischen Instrumentariums. Dass Meyer-Blanck, Deeg und Stäblein mit ihrem Vorgehen scheitern, spricht nicht gegen die Notwendigkeit, die frei gehaltene Predigt homiletisch zu reflektieren. Schade ist nur, dass sich die Autoren so in der Polemik gegen die vermeintliche Ideologie der freien Rede verzetteln, dass die guten und bedenkenswerten Ansätze in den Hintergrund treten. Ich sehe drei wichtige Ansatzpunkte:
Erstens: Predigtarbeit braucht Zeit. Das ist nicht neu, aber es gilt, die aktuellen Bedingungen der Predigtarbeit in der Homiletik mit zu reflektieren. Was bedeutet es für die Predigt, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer oft nicht mehr als drei Stunden für die Predigtvorbereitung aufwenden können? Stäblein sieht im Schreiben eine Möglichkeit, ganz bewusst aus der Vielgestalt der mündlichen Alltagskommunikation auszusteigen und sich dadurch in „Selbstdisziplin und Hingabe“ (S.11) zu üben. Auch wenn man von der Engführung auf die schreibende Vorbereitung absieht: Predigtvorbereitung setzt ein funktionierendes System von Zeit- und Selbstmanagement voraus. Das geht letztlich über die Predigtvorbereitung im engeren Sinne hinaus: So haben bereits Heribert Arens und seine Mitautoren in „Kreativität und Predigtarbeit“ Anfang der 1980er Jahre von einer „offensiven Predigtarbeit“ geredet, die eingebettet ist in eine kreative Lebenshaltung und nicht nur von der Hand in den Mund lebt, das heißt: nicht immer nur die nächste Predigt im Blick hat. Ansonsten droht, was Stäblein „Auspredigen“ nennt: „eine verengte, auf die ermüdende Reproduktion des immer Gleichen eingefahrene, für das schöpferische Moment kaum noch offene Wahrnehmung der [Predigt-]Aufgabe“ (S. 111).
Zweitens: Schreiben ist eine unverzichtbare Methode der Predigtarbeit. Man muss es ja nicht gleich mit Meyer-Blanck übertreiben und behaupten „Predigerinnen und Prediger sind Dichter“ (S. 22). Das stellt einen zu hohen sprachlichen Anspruch an die Predigt, vor dem nicht nur die freie Predigt kapitulieren muss. Aber in der Predigtarbeit auf „Poesie, Sprachkunst und Zeichenbildung“ zu setzen (S. 10), das gelingt schreibend besser. Deeg ist hier etwas nüchterner, wenn er in Predigern zwar „manchmal auch Sprachkünstler“ (87) sieht, aber in erster Linie sind Prediger Spracharbeiter und Kunsthandwerker der Sprache – wie Journalisten und Schriftsteller. In der bisherigen Homiletik und Predigerausbildung ist dieser Aspekt deutlich zu kurz gekommen. Predigen lernen heißt darum immer auch: Schreiben lernen – und zwar zu allererst als Handwerk – und manchmal sogar als Kunst.
Drittens. Die schreibende Predigtvorbereitung bietet ein starkes methodisches Instrument: die Möglichkeit der Überarbeitung. Dieses Grundelement der Schreibarbeit wird von der Autoren zwar nicht so genannt, aber wenn Deeg von der „Chance der Distanzierung“ schreibt (S. 78ff), ist genau dies gemeint. In einem kleinen Exkurs zeigt Deeg, dass schon in der antiken Rhetorik Schreiben eine wichtige Technik der Redevorbereitung war, die zwei Vorteile mit sich brachte: Wer schreibt, verlangsamt den Sprachfluss und ermöglicht die Suche nach dem besten Ausdruck. Und wer schreibt, kann kritisch auf das Geschriebene schauen und es korrigieren. Überarbeitung meint letztlich beides. Wer auf das Schreiben prinzipiell verzichtet, bringt sich um eine der stärksten Techniken der Textproduktion (vgl. S. 80).
Fazit
Meyer-Blanck, Deeg und Stäblein legen ein Buch mit guten und bedenkenswerten Ansätzen vor: den Zeitaufwand der Predigtvorbereitung im Pfarralltag zu bedenken, die Stärken des Schreibens herauszuarbeiten und großen Chancen zu sehen, die die Technik der Überarbeitung eines Manuskriptes für den Predigtvortrag bringt, das sind Punkte, die zu diskutieren sind. Leider haben sie nur am Rande etwas mit der Konzeption präsenten Predigens zu tun. Die Autoren verlieren sich zu sehr in Scheingefechten mit Ansätzen einer freien Rede, die es so nicht gibt. Statt mit einer Streitschrift gegen eine vermeintliche Ideologisierung der freien Predigt wären die Autoren mit einem Plädoyer für das Schreiben als unverzichtbarem Element der Predigtvorbereitung und der Orientierung an homiletischer Präsenz besser gefahren. So bleibt das Konzept des präsenten Predigens eigentümlich blass und auch die zentrale These, dass gerade die solide Manuskriptarbeit eine große Freiheit beim Predigtvortrag ermögliche, wird nicht ausgearbeitet. Am Ende wünscht man sich, die Autoren hätten selbst von der Möglichkeit, ihr Manuskript gründlich zu überarbeiten, mehr Gebrauch gemacht.
Deeg, Alexander, Michael Meyer-Blanck, und Christian Stäblein: Präsent predigen. Eine Streitschrift wider die Ideologisierung der „freien“ Kanzelrede. 1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. ISBN 9783525620014 | 17,95 € | 118 S. [Amazon-Link]
 Schreiben in Sozialen Netzwerken beeinflusst die Art und den Stil des eigenen Schreibens. Die Vernetzung mit Lesern, die zu Mitschreibern werden können, eröffnet ein weites Experimentierfeld. Stephan Porombka stellt im dritten Band der DUDEN-Reihe zum Kreativen Schreiben einige der Möglichkeiten vor. Das ist zwar nicht ganz das Thema dieses Blogs – aber da ich die anderen beiden Bände schon besprochen habe (1; 2), will ich der Vollständigkeit wegen ein paar Anmerkungen zu dem Buch machen.
Schreiben in Sozialen Netzwerken beeinflusst die Art und den Stil des eigenen Schreibens. Die Vernetzung mit Lesern, die zu Mitschreibern werden können, eröffnet ein weites Experimentierfeld. Stephan Porombka stellt im dritten Band der DUDEN-Reihe zum Kreativen Schreiben einige der Möglichkeiten vor. Das ist zwar nicht ganz das Thema dieses Blogs – aber da ich die anderen beiden Bände schon besprochen habe (1; 2), will ich der Vollständigkeit wegen ein paar Anmerkungen zu dem Buch machen.