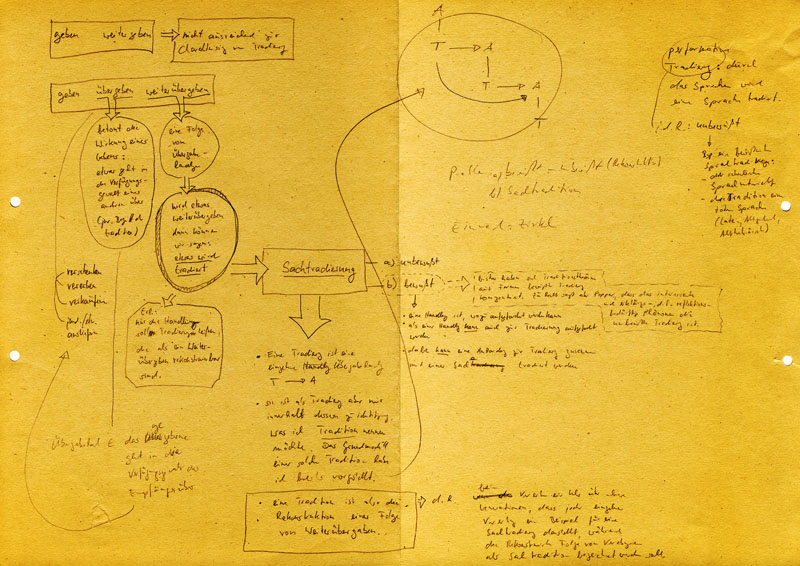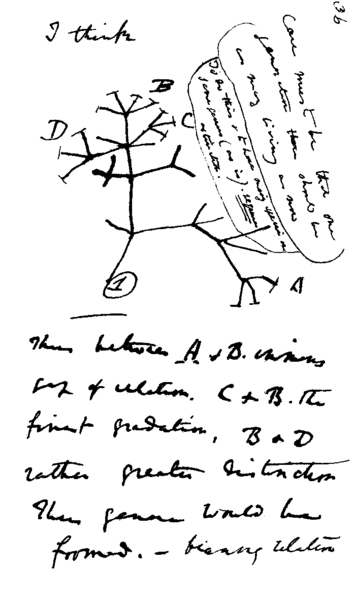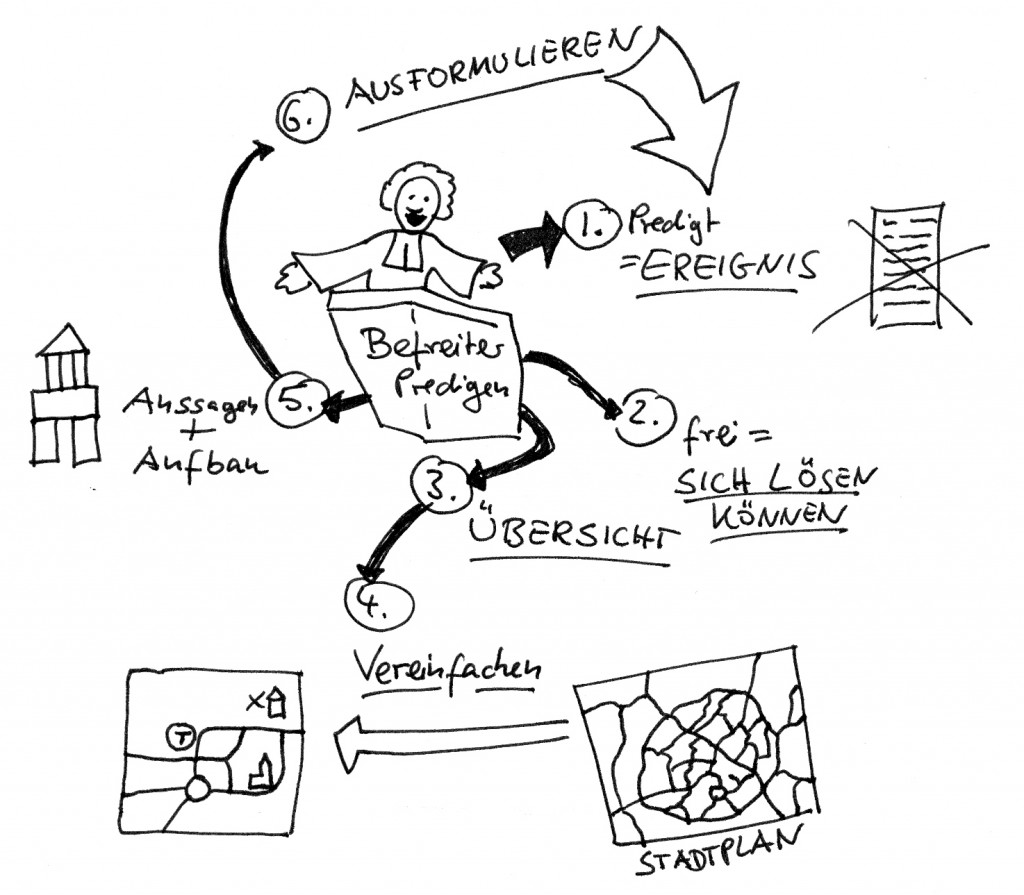Eine „Methodenlehre der Spannung“ verspricht Herausgeber Hanns-Josef Ortheil in seinem Vorwort zu Christian Schärfs „Spannend schreiben“. Der Untertitel verrät: Im fünften Band der DUDEN-Reihe „Kreatives Schreiben“ geht es um Krimis, Mord- und Schauerromane. Charakteristisch für die ganze Buch-Reihe ist der Versuch, in die Schreibwerkstätten ausgewählter Schriftsteller zu führen, um dort Anregungen für das eigene Schreiben zu bekommen. Das hatte bislang durchaus seinen Charme, tendiert in „Spannend schreiben“ aber stark zu einem germanistischen Proseminar. Auch wenn bei Schärf einige interessante Überlegungen zu finden sind – gemessen an dem Versprechen, eine „Methodenlehre der Spannung“ vorzulegen, muss das Buch enttäuschen.
Schärf nähert sich dem Begriff der Spannung auf rezeptionsästhetische Weise: Statt zu versuchen, einen allgemeinen Begriff von Spannung vorzulegen, schlägt Schärf vor, Spannung zu verstehen als „ein Phänomen, das zwischen den Akten der Herstellung eines Textes einerseits und seiner Wahrnehmung bei Lesern andererseits liegt“ (S. 10). Das Kapitel über die „Erschaffung des Lesers“ (S.119ff) gehört daher zu den interessantesten Abschnitten des Buchs. Die Kunstfertigkeit des Krimi-Autors liegt für Schärf letztlich nicht in der Verwendung literarischer Tricks der Spannungserzeugung, sondern in der „Einbindung des Lesers in die Aufklärungsarbeit“ (S. 121). Das wichtigste Instrument ist dabei die „Aussparung“ (S. 12) und die „Zurückhaltung von Information“ (S. 121): „Was wir als ‚spannend schreiben’ bezeichnen, hängt davon ab, inwieweit es dem Autor gelingt, einen Leser zu schaffen, der seine eigenen Projektionen und Hypothesen auf die Handlung bezieht und damit eine Identifikation mit dem Verbrechen und seiner Vor- und Nachgeschichte herstellt.“ (S. 123)
Das Phänomen Spannung äußert sich darin, dass ein spannender Text die Aufmerksamkeit des Lesers bindet. Das geschieht nicht einfach so: Solche „Spannung muss … erzeugt werden“ (S. 11), und zwar indem der Stoff, aus dem eine Geschichte besteht, dramatisiert wird. Das gelingt am einfachsten dadurch, dass der Autor Informationen zurück hält. Im Englischen steht dafür der Begriff der Suspense, den Schärf nicht ganz zutreffend als „Aufschub“ übersetzt. ‚To keep somebody in suspense’ bedeutet aber eher, jemanden in Ungewissen lassen bzw. auf die Folter zu spannen – in diesem Fall: den Leser. Auch wenn Schärf sich etwas unklar ausdrückt, meint er aber genau das.
Die Kernfrage ist dann also, wie es einem Autor gelingt, seinen Leser dazu zu bringen, sich auf die Folter spannen zu lassen. Auf diese Frage sollte eine Methodenlehre der Spannung Antwort geben – und genau hier setzt die Enttäuschung über das Buch ein: Auch wenn es durchaus gute methodische Hinweise gibt, mangelt es doch an einer systematischen Entfaltung. Das liegt meines Erachtens vor allem an Schärfs Grundannahmen und der Grundkonzeption des Buches.
Zweifellos interessant sind die Hinweise zum dem, was Schärf „Antizipation der Bedrohung“ (S. 20) nennt und die Überlegungen zur „Gestaltung von Zonen der Angst“ (S. 46). Es ist konstitutiv für die Angst im Unterschied zur Furcht, dass sich die Angst auf eine mögliche Bedrohung richtet. Diese Bedrohung anzudeuten, ihre Konkretion aber zu verzögern, schafft eine spannungsvolle Atmosphäre, die schrittweise aufzubauen ist: im einem zunächst gefahrlosen Raum gibt es erste Anzeichen einer Bedrohung, dies sich erst allmählich manifestiert und sich schließlich als echte Gefahr zeigt: im Schauerroman als übermenschliche Bedrohung, im Kriminalroman als unmenschliche. Die diffuse Angst schlägt in Frucht und Grauen um. Ein wichtiges Mittel ist dabei die Darstellung der Orte und Rahmenbedingungen als „Angstzonen“. Beides kann man sich sehr gut am Beispiel eines Films wie „Alien“ deutlich machen: in dem Science-Fiction-Film ist das Alien im überwiegenden Teil des Filmes gar nicht zu sehen; zur klaustrophobischen Atmosphäre trägt vor allem die Darstellung des Raumschiffs bei. Christian Schärf führt die klassische Verwendung dieser Stilmittel an Beispielen von Edgar Allan Poe, Bram Stoker und E.T.A. Hoffmann vor.
Die Grundannahme jedoch, dass das Phänomen der Spannung „keine empirisch zu bestimmende materielle Basis aufweist“ (S. 10) führt Schärf zu einer (durchaus begründeten) Skepsis gegenüber Patentrezepten der Spannung. Schärfs These von der Erschaffung des Lesers hebt ja zu Recht hervor, dass nicht jeder Leser sich von einem Text gefangen nehmen und auf die Folter spannen lässt. Der Autor kann im Einsatz seiner Spannungsmittel scheitern. Deshalb aber zum Beispiel ein beliebtes Mittel wie cliffhanger nur begrifflich zu erwähnen (vgl. S. 119), ohne das Mittel selbst vorzustellen, ist ein Manko. Ja, der übermäßige Gebrauch der Methode, ein Kapitel auf dem Höhepunkt der Spannung abzubrechen und verzögert fortzusetzen, ist auf Dauer einfallslos und ermüdet bald. Das zeigen zum Beispiel die Romane von Dan Brown, die fast nur mit diesem Mittel arbeiten. Trotzdem haben die Bücher ein Millionenpublikum gefesselt. Wer Alwin Fills sprachwissenschaftliche Analyse „Das Prinzip Spannung“ liest, wird auf eine verwirrende Vielzahl von empirisch bestimmbaren Elementen der Spannung auf allen Ebenen der Sprache stoßen: Kein Element muss, aber jedes einzelne kann Spannung erzeugen. Für eine Methodenlehre der Spannung wäre es eigentlich notwendig, die für die Praxis des kreativen Schreibens relevantesten Aspekte darzustellen. Das kommt in Schärfs Buch zu kurz.
Auch die Grundkonzeption mündet letztlich in eine Enttäuschung. Christian Schärf bezieht spannendes Schreiben ausschließlich auf Schauer- und Kriminalgeschichten. Seine plausibel ausgeführte These ist, dass sich der moderne Kriminalroman aus der gothic novel des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Den Prozess dieser Entwicklung zeichnet er nach, indem er zunächst Grundelemente der Angstspannung in der Schauerliteratur darstellt, und dann über die Erfindung der Detektivfigur und der Rätselspannung zu zeitgenössischen Thrillern gelangt. Schärfs Analysen sind interessant zu lesen und im Detail durchaus aufschlussreich. Spannend schreiben bedeutet aber mehr als Krimis zu schreiben. Auch ein Liebesroman lebt von der Spannung der Ungewissheit, ob sich die beiden am Schluss kriegen oder nicht. Das kann spannend sein „wie ein Krimi“. Auch mein „Alien“-Beispiel zeigt: Spannung gibt es nicht nur im Krimi. Es spricht natürlich nichts dagegen, Spannungsliteratur vorwiegend auf den Kriminalroman zu beziehen und exemplarisch vorzuführen. Eine Methodenlehre des spannenden Schreibens sollte aber ansetzen bei der allgemeineren Frage, welche erzählerischen Mittel zur Spannung einer Geschichte beitragen.
Wer nun wiederum denkt, er bekäme zumindest Hinweise zur Konstruktion einer Kriminalgeschichte wird ebenfalls enttäuscht sein. Im Kapitel zum Plotting (S. 92ff) findet man gerade keine Methoden zur Herstellung eines Plots, also eine Handlungslinie, sondern nur die Entfaltung zweier spezifischer Plotstrukturen: der Reise und des Wettstreits. Die Überlegungen zum Krimi als Reise in eine labyrinthische Struktur, die der Detektiv erkunden und entwirren muss (wie im klassischen Detektivroman) und der Krimi als Wettstreit zwischen Täter und Ermittler (etwa im Genre der Serienmördergeschichten) sind kenntnisreich geschrieben und interessant zu lesen. Auf die entscheidende Frage, wie man ein kriminalistisches Rätsel und Labyrinth entwirft, in das man Detektiv und Leser dann schickt, gibt Schärf aber keine Antwort.
Da helfen auch die Schreibaufgaben nicht weiter. Sie fordern zuweilen im Stile von schulischen Klausuraufgaben zur Analyse klassischer Texte auf oder ermuntern zur Imitation eines Stils bzw. die Verfassung von Pastichen. Im Unterschied zu früheren Bänden der DUDEN-Reihe finden sich in den Schreibaufgaben aber kaum methodische Bündelungen von Schreibverfahren exemplarisch vorgestellter Autoren.
Fazit: Eine „Methodenlehre der Spannung“ ist Christian Schärfs Buch „Spannend schreiben“ also nicht. Die Ausführungen sind zwar informativ und die Analysen können überzeugen, aber es fehlen grundsätzliche Überlegungen zu dem, was Texte und Geschichten – jenseits von Krimi und Grusel – spannend macht. Andererseits bietet das Buch auch kein spezifisches Handwerkzeugs zum Entwickeln eines Krimi-Plots. Die Stärken des Buches liegen darum eher in der Reflexion auf einige Grundlagen der klassischen Kriminalliteratur, weniger in der praktischen Anregung zum kreativ-spannenden Schreiben. Obwohl die als „Schreibverführer“ beworbenen Bücher gerade das versprechen. „Spannend schreiben“ löst dieses Versprechen nicht ein.
Christian Schärf: Spannend schreiben. Krimi, Mord- und Schauergeschichten, , 1. Aufl. Bibliographisches Institut, Mannheim, 2012. ISBN 978-3-411-75436-6| 14,95 € | 157 S.