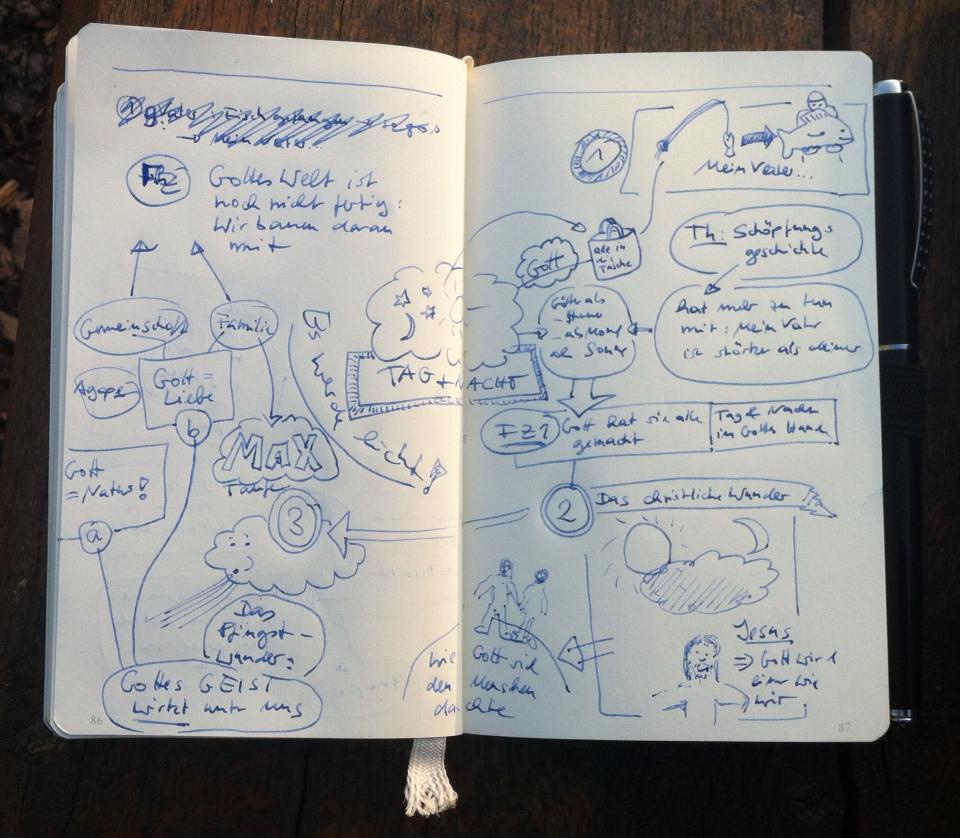Was Prediger mit ihrer Predigt erreichen wollen, lässt sich nicht allgemein sagen. Dass ein Prediger aber zumindest irgendetwas sagen will, wird normalerweise vorausgesetzt – auch wenn die Botschaft nicht immer ganz klar ist. Es gibt diesen alten Witz: Der Mann kommt vom Gottesdienst nach Hause kommt und sagt: „Heute hat der Pastor über 30 Minuten gepredigt.“ „Worüber denn?“, fragt die Ehefrau. Und der Mann antwortet: „Das hat er nicht gesagt.“ „Homiletik der Langeweile“ weiterlesen
Pfingstpredigt
Mini-Knigge – Regel 8: Blickkontakt suchen
Suche und halte Blickkontakt. Die Begegnung zweier Augenpaare ist ein kommunikatives Ereignis, das bei großen Gruppen unter besonderen Bedingungen stattfindet. Blickkontakt ist für die Liturgin oder den Prediger deshalb wichtig, weil sie so den Wunsch signalisieren, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten und ihre Aufmerksamkeit zu fordern. Umgekehrt nehmen Hörerinnen und Hörer, die den Blick auffangen, die Kontaktaufnahme an und signalisieren, dem Liturgen oder der Predigerin Aufmerksamkeit zu schenken. Die Besonderheit in der Kommunikation mit großen Gruppen ist: Das Gegenüber des Redners ist die Gruppe als Ganzes, es sind nicht die vielen Einzelnen. In der Kommunikation mit einer Gruppe wandert deshalb der Blick, verweilt einen Augenblick, wenn sich die Augenpaare treffen und bewegt sich dann weiter. Auch wenn nicht alle einen Blick erheischen entsteht doch der Eindruck in der Gruppe, gesehen und wahrgenommen zu werden.
Zwar kann der Blickkontakt ganz ohne Worte auskommen, für den Gottesdienst ist aber sein Zusammenhang mit Worten und Gesten sowie mit der jeweiligen gottesdienstlichen Rolle von Bedeutung. Während für die Predigerin der Blickkontakt unverzichtbar ist, ist er für den Liturgen an einigen Stellen völlig unpassend. Das Grundprinzip ist: Blickkontakt ist immer dann wichtig, wenn Sprecher und Hörer direkt miteinander kommunizieren. Kommt mit Gott oder dem biblischen Text ein dritter Kommunikationspartner ins Spiel, wird der Blickkontakt bewusst reduziert. Auch wenn es wie das Natürlichste der Welt erscheint: Den Blickkontakt bewusst suchen und halten oder aber reduzieren bedarf einiger Übung, um natürlich zu wirken.
Eindeutige Beispiele für den Blickkontakte bei direkter Kommunikation sind natürlich Predigt und Ansprache, weil hier der Prediger sich persönlich und direkt an die Gemeinde wendet. Je mehr ein Prediger sich vom Papier lösen kann, desto stärker kann er seine Worten und Gesten mit Blicken unterstützen und verstärken. Auch in der liturgischen Wechselrede ist Blickkontakt wichtig, weil Liturgin und Gemeinde direkt miteinander kommunizieren. Zwar bedient die Liturgin sich etwa beim Eingangsvotum und dem liturgischen Gruß geprägter Sprache, spricht aber die Gemeinde an. Ihr Blick unterstreicht, dass die Gemeinde die Angesprochene ist und die Worte nicht ins Leere gesprochen werden. Aus dem Eingangsvotum „Im Namen des Vaters …“ wird durch den gesuchten Blick der Gemeinde die unausgesprochene Aufforderung „Lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern.“ Ähnlich ist es bei Einleitungen zu Gebet und Lesung wie „Lasst uns beten …“ oder „Die Lesung für den Sonntag XY steht bei …“.
Unpassend ist der Blickkontakt, wenn nicht die Gemeinde angesprochen wird, sondern Gott. Auch wenn viele in der Schule gelernt haben, beim Vorlesen aufzublicken: Wer im Gottesdienst beispielsweise bei der Fürbitte den Blick immer wieder hebt, macht aus dem Gebet eine Art Gedichtvortrag. In Schulgottesdiensten wird dieser Vortrag deshalb oft statt eines „Amen“ entsprechend durch Applaus gewürdigt. Auch bei der biblischen Lesung selbst sollte der Blickkontakt eingeschränkt oder eingestellt werden. Anders ist es bei biblischen Voten, die als Zuspruch gesprochen werden. Beim Gnadenspruch oder beim Sendungswort unterstreicht der Liturg durch den Blickkontakt den Zuwendungscharakter des biblisches Verses, wobei er als Botschafter auf den eigentlichen Sprecher verweist („Christus spricht: ‚Kommt her zu mir, …’“).
Mini-Knigge – Regel 7: Auf- und Abtritte minimieren
Reduziere Auf- und Abtritte auf ein Minimum. Jede Bewegung im Raum zieht die Aufmerksamkeit auf sich und sorgt für Unruhe. Das ist an sich nicht schlecht: Der Wechsel von Bewegung und Ruhe geben dem Gottesdienst Rhythmus und Struktur. Das Betreten und Verlassen des liturgischen Raums an den Schnittstellen der Liturgie betont den Rhythmus des Gottesdienstes und signalisiert Veränderung. Diese Wirkung sollte gewissermaßen als liturgische Choreographie bewusst einsetzt werden. Dazu ist es notwendig, Auf- und Abtritte bei der Planung des Gottesdienstes zu berücksichtigen und bei den verschiedenen Beteiligten zu koordinieren. Denn je mehr Menschen liturgische Aufgaben in einem Gottesdienst haben, desto gründlicher ist zu bedenken, wer wann mit wem den liturgischen Raum betritt oder verlässt.
Ein negatives Beispiel aus eigener Erfahrung mag verdeutlichen, wie Auf- und Abtritte das liturgische Geschehen beeinflussen können: Bei einem Weltgebetstagsgottesdienst vor einigen Jahren stand für die ca. 30 Beteiligten nur ein Mikro am Ambo zur Verfügung. Statt in kleinen Gruppen aufzutreten, trat jede der beteiligten Frauen allein an den Ambo, auch wenn der Text noch so kurz war. Das Dreifach-Kyrie zerfiel so in Einzelteile und konnte kaum als Zusammenhang wahrgenommen werden. Der Kyriegesang wurde dabei als Gelegenheit für den Abtritt der einen und Auftritt der nächsten Sprecherin genutzt. Einzig für die Fürbitten trat eine Gruppe nach vorn. Besser wäre es gewesen, die Einheit des Kyrie-Gebets durch das gemeinsame Auf- und Abtreten einer ganzen Gruppe zu betonen.
(Bedenkenswert sind übrigens auch die Bewegung von liturgisch nicht Beteiligten, zum Beispiel Fotografen bei Trauungen. Will man das Fotografieren nicht ganz verbieten, sollte klar abgesprochen werden, welche Bereiche des liturgischen Raums der Fotograf wann betreten darf und wann nicht, und aus welchen Bereichen er sich ganz rauszuhalten hat.)
Ins Labyrinth der Zettel
Zettelkästen sind für viele, die schreiben, eines der wichtigsten, kreativen Werkzeuge. Eine Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach erlaubt im Jean-Paul-Jahr 2013 einen Einblick in die sonst verschlossenen Zettelwelten, denn in der Regel findet sich im Labyrinth der Zettel nur der zurecht, der es angelegt an. Wem die Reise an den Neckar zu weit ist, kann sich an einem großartig gestalteten Katalog erfreuen, der gerade erschienen ist. Neben einem 163-seitigen Textteil gibt es einen rund 220-seitigen Bildteil, der einen guten Einblick gibt in die Vielgestaltigkeit von Zettelkästen. Allein das Stöbern darin ist eine große Freude.
„Ins Labyrinth der Zettel“ weiterlesenMini-Knigge – Regel 6: Einfache und klare Gesten
Verwende einfache und klare Gesten. Gesten sind symbolische Bewegungen. Damit sind Gesten ein wichtiger Teil der Kommunikation im Gottesdienst. Ähnlich wie beim Reden gibt es auch bei den Gesten viel Überflüssiges und manch typisch Kirchliches. Es erleichtert das Verständnis von Gesten, wenn sie klar und einfach sind. Umgekehrt sollten Gesten vermieden werden, deren Bedeutung nicht eindeutig ist oder die keine liturgische Funktion haben.
Bei Gesten ist es gut und wichtig, sich klar zu machen, was die Geste symbolisiert: Die Segensgeste bildet zum Beispiel das Handauflegen nach. Dieses angedeutete Handauflegen sollte in der Geste auch zum Ausdruck kommen, und nicht etwa die Assoziation „Hände hoch“ auslösen. Eine andere typisch kirchliche Geste ist das Kreuzzeichen. Manche Liturgen scheinen das Kreuz mit mehreren Strichen in die Luft malen zu wollen, was für den Beobachter wie ein wildes Gefuchtel erscheint. Statt die Kreuzbalken mehrfach zu markieren, genügt eine eindeutige Bewegung mit klar erkennbarem Ansatz. Zu den unklaren und überflüssigen Gesten gehört, der Gemeinde das Aufstehen und Hinsetzen beispielsweise durch ein Kopfnicken und einen auffordernden Blick oder durch ein Winken mit der Kladde anzuzeigen: Diese Gesten sind weder eindeutig noch haben sie eine liturgische Funktion.
(Viele gute Beobachtungen und Überlegungen zu diesem Thema finden sich in Thomas Kabels Handbuch Liturgische Präsenz.)
Mini-Knigge – Regel 5: Vermeide Rechtfertigungen
Vermeide Rechtfertigungen und Selbsterklärungen. Bei einer Rechtfertigung geht es darum, sich nach einem Fehlverhalten in ein rechtes Licht zu rücken. Allerdings lenkt jede Rechtfertigung, Entschuldigung und Selbsterklärung die Aufmerksamkeit erst recht auf das, wofür man sich entschuldigt. Für den Gottesdienst ist das in der Regel etwas völlig unbedeutendes. Bei Kleinigkeiten sollte man deshalb kommentarlos darüber hinweggehen und fortfahren. Mutet ein Liturg der Gemeinde tatsächlich etwas zu, kann zwar eine kurze Bitte um Entschuldigung angebracht sein, weitergehende Erklärungen sind aber im Rahmen eines Gottesdienstes oder einer Andacht fehl am Platz.
Gründe für den Drang, sich zu rechtfertigen gibt es viele: zu spät kommen, etwas vergessen haben, sich versprechen, etwas verwechseln. Kaum etwas ist nerviger als jemand, der sich dauernd für Kleinigkeiten wie ein Versprechen entschuldigt. Selbst wenn man sich mehrfach beim Vorlesen verspricht: Es ist besser, einfach nicht drauf einzugehen, als jedes Mal ein „Entschuldigung“ einzubauen und am Ende gar noch eine Erklärung anzuhängen (das Licht sei so schlecht oder man habe die falsche Brille dabei etc. …). Auch bei extremeren Beispielen sollte man mit rechtfertigenden Erklärungen sparsam sein: Wer etwa bei einer Beerdigung zu spät kommt, sollte zu Beginn der Trauerandacht im Rahmen der Begrüßung kurz um Entschuldigung zu bitten und dann die Aufmerksamkeit auf den eigentlichen Grund der Zusammenkunft zu lenken. Im Mittelpunkt steht nicht das peinliche Gefühl des Liturgen, sondern die existentielle Betroffenheit der Trauernden.
Mini-Knigge – Regel 4: Mach Pausen
Mach genügend Sprechpausen. Dem Gottesdienst tut eine ruhige Gangart gut. Weil wir im Fernsehen und im Radio das pausenlose Reden gewohnt sind, wirken Pausen oft unprofessionell und wie Fehler: Sie scheinen ungenutzte Zeit zu sein. Das ist aber nicht so, sondern es ist wie in der Musik: Durch Pausen erhält jeder Gottesdienst seine besondere Struktur, seinen Rhythmus – in seinen Teilen wie als Ganzes. Neben dem Pausenzeichen, das für ein bewusstes Aussetzen sorgt, gibt es in der Musik auch das Atemzeichen als Signal zum Luftholen. Beides ist auch für den Gottesdienst wichtig. Pausen erzeugen die notwendige Spannung, um aufmerksam zu bleiben für die Feier des Gottesdienstes und im Hören der Predigt. Zudem: Wo, wenn nicht im Gottesdienst, könnte man lernen auch in die Stille und das Schweigen hinein zu hören?
Pausen sind gut und wichtig sowohl innerhalb der einzelnen liturgischen Bausteine wie den Gebeten, beim Lesen biblischer Texte und als auch bei der Predigt. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, wann Pausen möglich, sinnvoll, und oft sogar nötig sind: Jedes Komma, jeder Punkt, jeder Absatz und neuer Abschnitt ist ein Signal eine Pause zu machen – zum Luftholen oder zum bewussten, spannungserzeugenden Aussetzen. Bereits beim Verfassen der Predigt ist es sinnvoll, diese Pausen mit zu bedenken. Hilfreich ist, jedem einzelnen Gedanken einen eignen Absatz zu geben und größere Sinneinheiten durch Zwischenüberschriften zu gliedern. Jeder Absatz und Abschnitt dient dann als Pausenzeichen. Gerade bei der frei gehaltenen Predigt dient die Pause dem Prediger als kurze Neuorientierung: Wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Und die hörende Gemeinde hat Zeit und Ruhe, den Gedankenbewegungen der Predigt zu folgen.
Mini-Knigge – Regel 3: Sich Einleitungsformeln aneignen
Eigne dir Ein- und Überleitungsformeln an. Manche liturgischen Teile müssen eingeleitet werden, vor allem, um eine liturgisch nicht routinierte Gemeinde auf dem Weg durch den Gottesdienst mit zu nehmen. Dabei bewegen sich Liturgen zwischen zwei Extremen: Liturgischer Purismus auf der einen und geschwätziger Moderatorenstil auf der anderen Seite. Natürlich muss nicht jeder Schritt eingeleitet werden. Kennzeichen für die Notwendigkeit einer Einleitung- oder Übergangsformel ist, wenn man im liturgischen Vollzug merkt, dass man selbst oder die Gemeinde immer an der gleichen Stelle hakt und stolpert. Hier gilt es, sich bewusst Formeln anzugewöhnen, die kurz und nicht zu floskelhaft den nächsten liturgischen Schritt einleiten.
Typisches Beispiel ist die Einleitung des Glaubensbekenntnisses nach der Lesung oder die Einleitung des Vaterunsers nach der Fürbitte. Kurze Einleitungsformeln könnten sein: „Wir sprechen miteinander das Glaubensbekenntnis“ oder (falls die Gemeinde bei der Lesung sitzt) „Zum Glaubensbekenntnis bitte ich Sie aufzustehen.“ Zwar meinen liturgische Puristen, solche Regieanweisungen gehörten nicht zum Gottesdienst, aber erstens gewinnen nicht routinierte Gottesdienstbesucher aus klaren Hinweisen Sicherheit beim Mitfeiern des Gottesdienstes. Und zweitens ist es besser, zu sagen, welche Handlungen der Liturg von der Gemeinde erwartet, statt beispielsweise mit der Kladde das Aufstehen und Hinsetzen zu signalisieren. Der Moderatorenstil auf der anderen Seite will in oft launig-lockerer Form „durch den Gottesdienst führen“ und gerät dabei leicht ins unkontrollierte Plaudern. Sich bewusst zu überlegen, welche Ein- und Überleitungsformeln man verwendet, hilft, einen Moderatorenstil ad hoc zu vermeiden.
Mini-Knigge – Regel 2: Auswendig sprechen
Lerne wichtige Texte und liturgische Blocks auswendig. Der Gottesdienst lebt als gemeinsame Feier davon, dass Liturgen und Gemeinde miteinander kommunizieren. Hilfreich für das Gelingen liturgischer Kommunikation ist, wenn liturgische Texte auswendig gesprochen und nicht abgelesen werden, denn dann können Liturgen die Gemeinde ansehen, wenn sie sie ansprechen. Selbst wenn es nicht um im Wechsel gesprochene, liturgische Texte geht, ist das auswendig sprechen Können gut und wichtig. Die Gottesdienstkladde sollte nicht zum Messbuch werden. Nur Gebetstexte und Lesungen können tatsächlich abgelesen werden, weil hier ein kommunikatives Aufblicken in die Gemeinde fehl am Platz ist.
Was Liturginnen und Liturgen auch ohne Kladde auswendig sprechen können sollten, kann sich beispielhaft daran orientieren, was auch Konfirmandinnen und Konfirmanden auswendig lernen müssen: Vaterunser, Glaubensbekenntnis, Gloria Patri, Gloria in excelsis und Einsetzungsworte. Auch ganze liturgische Blöcke sollten kladdenfrei präsent sein. Mit „liturgischen Blöcken“ sind zusammenhängende, liturgische Schritte gemeint, die je nach Gemeinde unterschiedlich sein können. So kann der Einleitungsblock zum Beispiel die Abfolge sein von Votum zur Eröffnung, Gruß, Psalm und Gloria Patri. Und natürlich müssten Liturginnen und Liturgen schließlich den Blick von der Kladde auch wirklich lösen und auswendig mit Blick in die Gemeinde sprechen – insbesondere, wenn es um Wechselrede oder direkte Ansprache geht.