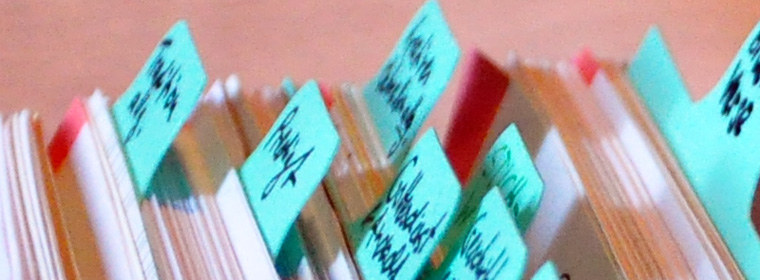Trocken und eintönig zu sein, das ist der Ruf, der wissenschaftlichen Texten oft vorausgeht, wenn sie nicht gleich ganz als unlesbar gelten. Auch wenn das nicht immer abzustreiten ist, hat sich daran in den letzten zwei Jahrzehnten einiges geändert. An den meisten Universitäten gibt es heute beispielsweise Schreibzentren. Sie geben nicht nur praktische Anleitungen für das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten. Auch Methoden des Kreativen Schreibens haben längst Eingang ins wissenschaftliche Schreiben gefunden. Viele Bücher über das Anfertigen von Haus-, Bachelor- oder Masterarbeiten konzentrieren sich auf die formalen Anforderungen wie korrekte Zitierweisen. Ausnahmen sind Frank L. Cioffis (auf Deutsch vergriffenes) „Kreatives Schreiben für Studenten & Professoren“ und Ulrike Scheuermanns „Schreibdenken“. Julia Genz hat gerade eine gute Ergänzung vorgelegt: „Wissenschaftlich arbeiten mit kreativen Techniken“.
„Wissenschaftlich kreativ“ weiterlesenDie eigene Geschichte erzählen
„Erzähl uns deine Geschichte!“ – Diese einfache Aufforderung bringt Bobette Busters Storytelling-Ansatz auf den Punkt. Buster ist davon überzeugt, dass jede und jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Das Problem ist nur, dass diese Geschichte oft überlagert ist von der Angst, zu viel von sich preiszugeben, seine Wunden zu zeigen oder zu meinen, dass man nichts interessantes zu erzählen hat. Deshalb wird die Geschichte dann künstlich aufbauscht mit Fakten und Details, die keinen interessieren. Die „Story hinter der Story“ (S. 65 ff) freizulegen, und die eigene Geschichte so zu erzählen, dass die Welt zuhört – darum geht es in „Story“.
„Die eigene Geschichte erzählen“ weiterlesenMit Fingerübungen beginnen
„Aller Anfang ist schwer“ oder „Anfangen ist leicht“ – Sprichwörter transportieren oft sehr gegensätzliche Erfahrungen. In der Tat: Den einen fällt es leicht, etwas Neues anzufangen, nur haben sie Schwierigkeiten, dabei zu bleiben. Andere warten auf einen entscheidenden Impuls um anzufangen und schieben den Start vor sich her. Diese Erfahrungen machen auch Menschen, die schreiben. Die einen haben die Schublade voller vielversprechender Anfänge, die anderen den Kopf voller Ideen, aber das Blatt bleibt leer. „Mit Fingerübungen beginnen“ weiterlesen
Anstiftung zum Querdenken
Kreativ war am Anfang nur Gott. Der Mensch formte nach, schuf aber nicht neu, schon gar nicht aus dem Nichts. In der Neuzeit trat dann allerdings das schöpferische Individuum auf den Plan. Von Kreativität war da zwar noch nicht die Rede, aber von Genialität. „Anstiftung zum Querdenken“ weiterlesen
Kreativ Schreiben und Lesen
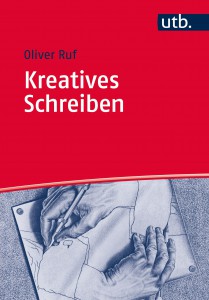 Schreiben und Lesen stehen in einem engen Zusammenhang: “Man muss abwechselnd beides tun und das eine mit Hilfe des anderen zügeln”, schreibt Foucault im Verweis auf Seneca. Auch Oliver Ruf bezieht in seiner Einführung in “Kreatives Schreiben” Lesen und Schreiben aufeinander. „Kreativ Schreiben und Lesen“ weiterlesen
Schreiben und Lesen stehen in einem engen Zusammenhang: “Man muss abwechselnd beides tun und das eine mit Hilfe des anderen zügeln”, schreibt Foucault im Verweis auf Seneca. Auch Oliver Ruf bezieht in seiner Einführung in “Kreatives Schreiben” Lesen und Schreiben aufeinander. „Kreativ Schreiben und Lesen“ weiterlesen
Von Hentig über Kreativität
Kreativität scheint eine Art universales Heilmittel zu sein, aber auch wenn der Begriff von vielen gebraucht wird: Er ist überraschend unpräzise. Zu diesem Fazit kommt Hartmut von Hentig in seinem 1998 erstmals erschienen Essay „Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff“. Die Begriffsschwäche rührt her von zwei Unklarheiten: Zum einen ist unklar, ob Kreativität etwas ist, das wir in der Gegenwart besonders benötigen und deshalb auch einsetzen, oder ob sie nötig wäre, aber noch unverfügbar ist. Zum andern ist unklar, ob Kreativität ein Mittel ist oder ein Ziel. Von Hentig ist skeptisch, denn ob Kreativität ein Mittel ist, uns aus dem als festgefahren wahrgenommen Zustand unserer Zeit zu befreien, muss sich erst noch zeigen. „Von Hentig über Kreativität“ weiterlesen
Predigten komponieren
Schreiben führt in der Predigtvorbereitung zwar nicht zwingend zu guten Predigten, kann aber helfen, “theologische und lebenspraktische Themen intellektuell zu durchdringen, sowie … sich Glaubensinhalte und Traditionsfragmente anzueignen. Predigtschreiben kann dazu beitragen, dass Pfarrpersonen in ihrer seelischen, geistigen und geistlichen Existenz wachsen.“ (S. 372) Zu diesem Ergebnis kommt Annette Müller in ihrer Dissertation “Predigt schreiben”. Sie hat dafür empirisch untersucht, was eigentlich geschieht, wenn Predigerinnen und Prediger ihr Predigtmanuskript erstellen. Damit kommt dem Schreiben in der Predigtvorbereitung eine wichtige Funktion zu: Es wird “eingesetzt, um kreativ und verantwortlich Theologie zu treiben“ (S. 394). „Predigten komponieren“ weiterlesen
Mit Jugendlichen zur Sprache kommen
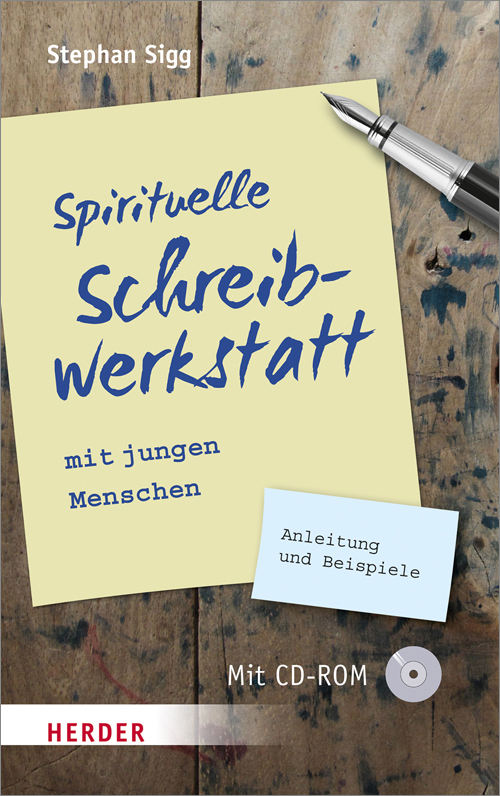
Stephan Siggs „Spirituelle Schreibwerkstatt“ hat mich im Laden gleich angesprungen – aber trotz guter Ideen ist das Buch auch eine Mogelpackung. Treffender wäre ein Titel wie „Mit Jugendlichen zur Sprache kommen. Reden und Schreiben über den Glauben.“ Aber wahrscheinlich hätte ich das Buch bei so einem Titel eher liegen gelassen. Die „Spirituelle Schreibwerkstatt“ (mit dem Untertitel „mit jungen Menschen“) ist auf jeden Fall der ansprechendere Titel. „Mit Jugendlichen zur Sprache kommen“ weiterlesen
Robinsons Rat zum Zettelkasten
In Haddon Robinsons Buch „Predige das Wort“ (Originaltitel: Biblical Preaching) wird sehr schön der Einsatz von Zettelkästen für Prediger beschrieben. In seinem Kapitel über die lebendige Ausgestaltung eines Predigtentwurfes mit illustrierendem Material schreibt Robinson:
„Das meiste Material findet der Prediger zweifellos in seiner eigenen Sammlung. Deshalb sollte es sich ein gutes Ordnungssystem dafür anlegen. Denn was er dort für seine Predigt findet, hängt völlig davon ab, was und wie er es hinein getan hat. Es gibt viele Systeme, um die Ergebnisse des Studiums und Lebens zuordnen. Normalerweise benötigt man zweierlei Karteien. In die eine Großformatige ordnet man Predigtnotizen, Auszüge und Kopien so, wie sie sind. Sie können eingeteilt sein nach Themen oder nach den Büchern der Bibel.
„Robinsons Rat zum Zettelkasten“ weiterlesenÜber mich selbst schreiben
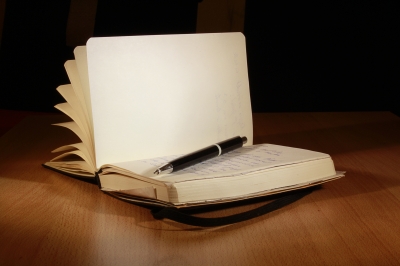
„Ich könnte ein Buch schreiben“, sagen Menschen häufig, wenn sie aus ihrem Leben erzählen. Doch obwohl viele Menschen gern von ihren Erlebnissen erzählen, gehen die wenigsten den nächsten Schritt, tatsächlich ihr Leben niederzuschreiben. Ratgeberliteratur zum Thema Autobiographie gibt es reichlich. Es scheint also Bedarf zu geben. Nun hat sich Hanns-Josef Ortheil als Autor und Herausgeber der DUDEN-Reihe Kreatives Schreiben des Themas angenommen: „Schreiben über mich selbst“ versteht Ortheil aber „nicht nur [als] eine beliebige, literarische Praxis unter vielen anderen, sondern [als] Teil einer umfassenderen ‚Lebenskunst‘ “, bei der es darum geht, „die eigene Existenz zu beobachten, zu reflektieren und zu durchdringen“ (S. 147). „Über mich selbst schreiben“ weiterlesen